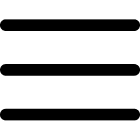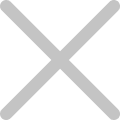SEVAK ARAMAZD, DIE STEPPE
Erzählung, 1988
Aus dem Armenischen ins Deutsche übersetzt
von
NAIRA SUKIASYAN UND KARINE HOVHANNISYAN
Kapitel 1
Durch unnatürlich üppige Brennnesseln gingen wir in der Steppendämmerung erschöpft das hohe Flussufer hinauf. Auf der Anhöhe, inmitten hügelhöher Schlamm und Müllhaufen, von hohen Binsen umgeben, stand unser transportabler Wohncontainer. Er war zwar dunkel und schmutzig, doch am ganzen Horizont der einzige Punkt, der für uns einen einfachen und gewissen Sinn hatte: Zuhause.
Vorne ging, mit den Händen rudernd, mein Dorfgenosse. Da er genauso alt war wie ich, nahm er sich das Recht heraus, unsere Lage, die zugegebener Maßen alles andere als rosig war, offen und heftig zu kritisieren: Zunächst schimpfte er auf die Welt, dann kam er auf unseren Arbeitsauftrag zurück, anschließend ging er durch giftige Anmerkungen auf unseren Auftraggeber los; zum Schluss hielt er bei mir an: „Du…“, und schoss sofort bergauf: „Ich…“. Er war felsenfest überzeugt, wenn wir dies oder jenes nicht so, sondern anders gemacht hätten, wie er „schon damals“ gesagt hätte, obgleich er dazu nichts gesagt hatte, so wäre also alles bestens gelaufen und nicht wie jetzt… Er war früher Hirte gewesen und verachtete die Bauarbeit, zu der wir herangezogen worden waren. Insgeheim fand er es erniedrigend, sicDh eingestehen zu müssen, dass die Arbeit ihn ermüdete. Er versuchte das zu überspielen, indem er sich lässig gab und wie ein Wasserfall redete.
In solchen Situationen kratzte ich mich hilflos am Kopf, bis es mir unerträglich wurde, zu seinen Ausführungen weiter zu schweigen. Wenn ich ihm eine Abfuhr erteilen wollte, kam ich auf die junge Staatsanwältin zu sprechen, die aus Moskau angereist war, und mit der er sich während meiner Abwesenheit eingelassen hatte.
Es machte mir Vergnügen, ihm vorzuhalten, wie die „Staatsanwalt studierende“ Frau mit dem pickligen Gesicht, wie er sich ausdrückte, ihn übers Ohr gehauen hatte. Sie hatte unsere letzte, für den Notfall reservierte Flasche armenischen Kognak geleert, ihm eine völlig wertlose Uhr für 100 Rubel angedreht, und wie sich später herausgestellt hatte, auch noch nebenbei seinen Familientalisman, ein schlangenverziertes goldenes Zigarettenetui, geklaut, und zwar unter einer Reihe von Ablenkungsmanövern, Gelächtern, schamlosen Witzen und Schäkereien, die er vermutlich für ein stolzes Zeichen ehrlicher Zuneigung gehalten hatte.
Doch jedes Mal, wenn sich unsere Blicke begegneten und ich in seine matten Augen sah, wurde ich durch das Gemisch aus Angst und Sorge, das ich dort wahrnahm, besänftigt. Es fiel mir unwillkürlich ein, wie er nachts im Schlaf mit seinen 4000 km entfernten Kindern sprach, wie er mit ihnen spielte und ihre kleinen Köpfe streichelte. Es überfiel mich Mitleid mit ihm, wenn er dabei sein schmutziges Kopfkissen an sich zog und lachte, und ich dachte, er hat keine Schuld: ich sei der Schuldige, dumm und unbeholfen, und es ist nicht mein Haus, dessen Wände Risse bekommen haben, es sind nicht meine Kinder, die eines Tages unter den Trümmern liegen könnten…
Ich fand einen Ausweg. Auf dem Rückweg zu unserem Quartier, dem Container, wechselte ich meinen Platz in der Kolonne. Ich ging nun als Letzter, und hielt mich dicht hinter dem Rücken meines Vordermanns, des dritten der vor mir herlaufenden Jungs. Derart abgeschirmt, störte mich das hochtrabende Geplapper meines Altersgenossen nicht mehr so sehr. Doch als er sich als Anführer unseres Zuges von Galgenvögeln aufzuspielen begann, ging mir das wieder ziemlich schnell auf die Nerven.
„Du ziehst ja sämtliche Register!“, stichelte ich und wunderte mich, dass ich keine Antwort bekam. Als er aber dem Dritten, der vor mir herangegangen war, fahrlässig-nebenbei sagte: “Mach die Tür auf!”, besann ich mich, dass ich diese Worte nur vor mich hin gesprochen hatte.
Der Dritte, dem der Befehl meines Altersgenossen galt, ein magerer junger Mann von mittelgroßer Statur mit großen Augen und einer langen Nase, holte mit den uneiligen Bewegungen eines Soldaten den unter einem Stein versteckten Schlüssel für unseren Container hervor.
Er stammte aus einem Dorf in Berg-Karabach. Ich hatte ihn in der Eisenbahnstation irgendeiner Siedlung in Tatarien entdeckt. Als ich dort Wasser trinken gegangen war, hatte ich ihn auf dem Rückweg in einer stillen Ecke gesehen. An seiner schmutzigen, abgetragenen Uniform hatte ich erkannt, dass er sich bereits längere Zeit in der Gegend aufgehalten hatte. Er saß auf seiner Reisetasche und kaute Sonnenblumenkerne, während er sich heimlich umsah. Seinen Antworten auf meine Fragen war zu entnehmen, dass er beim Militär abgedient hatte, aber nicht nach Hause zurückkehren konnte, weil ihm angeblich zwei Kameraden, ein Tschuwasche und ein Russe, den für die Heimreise bestimmten Sold gestohlen hatten; auch wollte er nicht mit leeren Händen nach Hause kommen, um seinen kranken Eltern die Unkosten für neue Bekleidung zu ersparen; er wollte sich eine Arbeit suchen und falls er Glück hätte, ein paar Jahre hier in der Gegend bleiben, vielleicht ließe sich hier etwas aufbauen... Ich konnte verstehen, dass er nicht heimkehren wollte. Da ich seine Lage gut nachfühlen konnte und von ihm einen gutmütigen Eindruck bekam, schlug ich ihm vor, sich uns anzuschließen.
Der Berg-Karabacher quälte sich lange mit verrostetem Vorhängeschloss, bis ihn mein Altersgenosse, vor sich hin brummend, mit der Schulter zur Seite stieß und selbst die Tür aufsperrte. Als wir eintraten und Licht machten, liefen die Ratten auseinander und verschwanden in ihren Löchern. Mein Altersgenosse warf mit seinem Schuh nach einer der Ratten, traf sie jedoch nicht, was ihn offensichtlich ärgerte.
„Dass ich nicht…“ fing er an, sprach den Satz jedoch nicht zu Ende, sondern zog seine verschwitzte Kleidung aus und sank nackt ins Bett.
Obwohl das einzige Fenster des Containers fest zugeschlossen war, waren große Sumpfmücken und Fliegen eingedrungen. Sie stürzten sich auf meinen Altersgenossen, ließen sich auf seinem schweißbedeckten Körper nieder, doch er war daran gewöhnt und unternahm keinen Versuch, sie zu verscheuchen. Auch wir andern zogen unsere Kleidung aus und machten uns auf den Betten lang, allerdings nicht auf die übliche Weise, sondern, wie mir schien, seinem Beispiel folgend. Und er schien es zu bemerken, er schien seiner Vorbildfunktion für uns sicher zu sein, sie mit Selbstverständlichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Diese Beobachtung und die Gedanken, die ich daran knüpfte, ärgerten mich. Ich drehte mich unruhig von einer Seite auf die andere und ließ meine Wut an den Fliegen aus: Es gäbe in der ganzen Welt kein schmutzigeres, hässlicheres Ungeziefer als diese Fliegen..!
„Bruder“, entgegnete er tiefsinnig aus seinem Bett, „ist es keine Fliege, dann sind es Schnacken...“
Ich schwieg.
Dann aber herrschte im Container wieder eine feindliche Stille, und ich fragte mich, warum wir tagsüber bei der Arbeit offen miteinander umgingen, uns sogar gegenseitig aufzogen, ohne dass sich deswegen jemand beleidigt fühlte, spätabends aber, wenn wir in den Container zurückkehrten, einander belauerten oder uns gegenseitig auf die Nerven gingen. Immer wieder ergriff ich vor dieser Situation in Gedanken die Flucht. Ich stehe nachts heimlich auf und laufe davon, vor der Arbeit, vor mir selbst, vor was weiß ich, weit weg, egal wohin. Oder die Jungs stehen morgens früh auf und laufen, da ich nicht da bin, hinaus. Sie starren entsetzt auf den dunklen Spiegel des Flusses, plötzlich entdecken sie mich, zwischen den hohen Binsen, halb im Wasser. Mein Rücken ist im Nebel kaum zu sehen, ich liege ertrunken im Fluss. Doch das war eine andere Geschichte, die Geschichte meines ertrunkenen Bruders, die Geschichte eines Anderen...
Ich schlug mir gegen die Stirn, wischte mir den Schweiß ab und drehte mich um.
Im Nebenbett lag unser Vierter, der, der im Herbst heiraten wollte. Ich sah ihn mir an, irgendwie sah er nicht gut aus. Ich hatte ihm Mut gemacht. Das wird schon klappen, mit deiner Hochzeit, hatte ich zu ihm gesagt. Irgendwie fühlte ich mich für ihn verantwortlich. Er war ein Dorfjunge, aber er hatte nichts mit einem Bauern gemeinsam. Er war hellhäutig, hatte einen weichen, rundlichen Körper, keine Muskeln wie ein Mann, kleine Augen und Hände wie ein Mädchen. Unentwegt starrte er an die Decke und bohrte mit dem Finger in der Nase.
„Vorsicht“, sagte ich spöttisch, „brich dir nicht den Finger dabei...“
Er warf mir einen abwesenden Blick zu. Offenbar hatte er nicht zugehört. Dann faltete er die Hände über dem Bauch, die mir jetzt vorkamen, wie ein Haufen mürbes Fleisch. Dieser Dummkopf, dieser verlogene Dummkopf, dachte ich bei mir, gleich fängt er wieder an zu spinnen... Denn er war offenkundig ein Lügner und ein Dummkopf dazu, denn ständig erzählte er irgendwelche Geschichten, in denen es um die Entführung von Mädchen ging. Er veränderte die Geschichten jedes Mal, erfand etwas hinzu oder ließ etwas weg, doch jedes Mal endeten sie damit, dass einmal ein Mann in sein Dorf gekommen war, ein Mann, dem man sofort ansah, dass es sich bei ihm um einen Beamten von der Gebietsverwaltung handelte, der unter mehr als hundert Bewohnern ihn ausgesucht und ihm die Reinigung und Wäsche seines Dienstwagens anvertraut hatte. Mit dieser Geschichte rückte er jedes Mal heraus, an ihr klammerte er sich fest, wenn er niedergeschlagen war.
Sein Mund war etwas schief. Seine Oberlippe war links nach oben aufgesprungen, und wenn er herumzufaseln begann, hatte ich stets den Eindruck, das hinge mit diesem Teil seines Mundes zusammen. Ich weiß nicht warum, behandelte ich ihn äußerst liebenswürdig; ich tat so, als legte ich auf seine Meinung besonderen Wert, und hörte mir geduldig seine Lügengeschichten an...
Die Stille wurde unerträglich. Eine Fliege hatte sich auf meinem Rücken niedergelassen. Ich spürte, wie sie hin und herlief, innehielt und weiterlief. Mir fiel ein, dass jemand zur Alten mit der Ziege gehen musste, um Holz zu hacken, sonst würden wir ohne Abendbrot bleiben. Mit diesem Gedanken kehrte mein Selbstvertrauen zurück. Ich war der Führer unserer kleinen Gruppe, ich behielt den Überblick. Ich setzte mich auf und sah mich um. Ich wartete eine Weile, ob sich einer der anderen erinnern würde, was zu tun sei, aber der Anblick ihrer erschöpften Körper lenkte meine Gedanken in eine andere Richtung.
So liegen sie in der Fremde, dachte ich, in einem schmutzigen Wohncontainer. Wie Waisenkinder, gottverlassen, ganz auf sich allein gestellt, und es bleibt offen, was morgen kommt. Ich betrachtete ihre Körper, ihre schwarzen Köpfe, es waren Landsleute, Armenier, bei ihrem Anblick schnürte es mir die Kehle zu. Und ich ärgerte mich über meinen Altersgenossen. Du bist schuld, dachte ich, diese Russin hat alles verdorben. Sie wird in Moskau herumstolzieren und sich damit aufblasen, dass sie die Armenier hereingelegt hat...
Plötzlich tauchte vor meinem Innern wieder sein Gesicht auf, das Gesicht dessen, den sie uns als gottähnliche Autorität präsentiert und dem wir unbedingte Gefolgschaft zu leisten hatten. Er hieß Iwanytsch, aber dieser Name wollte nicht zu ihm passen. Es überraschte mich, dass er überhaupt einen Namen hatte. Für mich war er nur die namenlose Respektsperson, die uns gegenübertrat. Seine ständig halbgeschlossenen Schlitzaugen, die spitze Nase und das spitze Kinn, die schmalen Lippen und der schwere Schritt, die gebieterische Haltung, mit der er auftrat, und das Fürchterlichste, das eisige Schweigen, mit dem er sich uns unbemerkt näherte und uns beobachtete, hatten sich mir eingeprägt. Und sein unbewegtes Gesicht, die zusammengepressten Lippen, wenn er uns zusah, wie wir uns schweißgebadet an den riesigen Massivsteinblöcken abquälten, die wir den Hügel hinaufrollten. Unsere tägliche Arbeit, die Mühe, die sie uns bereitete, unsere Anwesenheit hier, all das schien keine andere Bedeutung zu haben, als davon Zeugnis abzulegen, dass er schon immer da war und auch in Zukunft immer da sein würde. Ob er Tatar, Russe, Ghurghuse oder sonst etwas war, wussten wir nicht, aber jedes Wort von ihm, das uns anging oder uns gelten könnte, versetzte uns, wie gleichgültig er es auch aussprechen mochte, in einen Zustand voller Hoffnung: Er würde uns nicht hereinlegen, arbeiten lassen und dann hereinlegen; er hat ja selbst einmal – als die Sache gut zu laufen begann- das Wort verloren, die Armenier wären gute Bauarbeiter…
In den kurzen Pausen, in denen wir etwas aßen oder herumhockten und rauchten, sprachen wir ständig darüber, was dieser oder jener Blick oder eine Handbewegung von ihm zu bedeuten hätte. Dabei hofften wir stets, dass er mit uns zufrieden sei. Doch je länger unser Arbeitsauftrag dauerte, umso größer wurden unsere Zweifel. Denn er schien das Interesse an uns zu verlieren und ließ sich immer seltener blicken, bis er schließlich überhaupt nicht mehr kam, sondern nur noch seine Stellvertreter schickte, irgendwelche Leute, die nach dem rechten sahen, und uns gleichgültig oder feindlich behandelten. Aus den üblen Erfahrungen, die ich in ähnlichen Situationen gemacht hatte, konnte ich mir ausrechnen, dass die Sache wie gewohnt nicht gut ausgehen würde, und diese Vermutung ließ mir die Galle überlaufen.
An dem Tag, an dem wir ihn zum letzten Mal sahen, transportierten der junge Mann aus Berg Karabach und ich Ziegelsteine auf einer Trage. Als wir das letzte Mal aufluden, fiel mir auf, dass nur das Krachen der Ziegel zu hören war, die ich auf die Trage warf. Da ich aber gleichzeitig im Kopf berechnete, wieviel Steine wir noch auf die Trage werfen mussten, achtete ich nicht darauf. Erst als die Trage beladen war, sagte ich wie üblich „Los!“, doch der Berg-Karabacher reagierte nicht. Ich hob den Kopf und sah mich um; er hatte sein Hemd aus dem Gebüsch geholt, schüttelte es sorgfältig, um es... Er war also da, Iwanytsch, unser Abgott, und suchte eine Sitzgelegenheit. Ich konnte zunächst nicht fassen, was das den Berg-Karabacher anging, doch dann erfasste ich die Situation und das Blut schoss mir in den Kopf. „Du Idiot“, schrie ich zornig, „bist du denn sein Lakai? Komm zurück, schneller, wir müssen uns ohnehin ständig unterordnen...!“ Der Berg-Karabacher zögerte, er wusste offensichtlich nicht, was er tun sollte. Aber Iwanytsch sah uns zu, und der Berg-Karabacher nahm schließlich sein Hemd und legte es sorgfältig zusammengefaltet auf einen Stein, den Iwanytsch ihm mit einem kurzen Kopfnicken anwies. Ich drehte mich um, um nicht ansehen zu müssen, wie sich Iwaytsch seine Hose hochzog und sich hinsetzte. Ich ließ mich zwischen den Ziegeln nieder. Ich war deprimiert und verzweifelt. Ich schimpfte vor mich hin, redete mit mir selbst, wischte mir den Schweiß von der Stirn. Ich wurde taub und gefühllos. Während ich vor mich hinredete, kam mir die eigene Stimme wie die eines Fremden vor. Ich fühlte nichts mehr, weder die Ziegelsteine, zwischen denen ich saß, noch den Schlamm an meinen Füssen, auch der Himmel über meinem Kopf schien sich aufgelöst zu haben... Als meine Sinne langsam zurückkehrten, bemerkte ich, dass Iwanytsch mich aufmerksam beobachtet hatte, und ich dachte, dass das ein Nachspiel für mich haben würde, dass es das Ende bedeuten könnte. Schließlich erhob er sich und gab seinen herbeieilenden Leuten einige flüchtige Anweisungen. Dann stieg er in den Wagen und fuhr weg. Ich hatte einen Fehler begangen und war am Boden zerstört. Den Rest des Tages führte ich ein geheimes Zwiegespräch mit ihm, ich versuchte in Gedanken die Situation rückgängig zu machen, ich schmeichelte ihm, versuchte ihm alles zu erklären, mich ihm gegenüber in ein gutes Licht zu setzen, aber es war vergebens. Und ich begriff, dass es meine Schuld war, dass ich alles verdorben hatte...
Ich stand mit einem Ruck vom Bett auf. „Man sollte das Leben einfach aufgeben“, brummte ich vor mich hin, während ich das Gefühl hatte, langsam unterzugehen. Die klebrige Schwüle im Raum streifte mein Gesicht. Ich ging zur Tür und bemühte mich, die Jungs nicht anzusehen. In dem über dem Waschbecken angebrachten gesprungenen Spiegelstück sah ich plötzlich mein Gesicht. Einen dunklen, unbestimmten Schatten, der kurz auftauchte und wieder verschwand, und mir schien, ich hätte die unsichtbare Grenze des Jenseits überschritten...
Kapitel 2
Draußen herrschte Finsternis. Nichts regte sich, kein Windhauch war zu spüren. Vor mir lagen dunkle, undurchdringliche Schilfmassen. Der Fluss war nicht zu sehen, er war in der Dunkelheit nicht vom Schilf zu unterscheiden. Mir fiel ein, dass ich am Vortag am Ufer Wäsche zum Trocknen ausgebreitet hatte. Der Gedanke an die im Gras trocknende Wäsche freute mich. Ich trat in den dunklen Schilfwald und lief auf einem schmalen Pfad zum Fluss hinunter. Plötzlich hörte ich Teile eines Gesprächs, dann ertönte vom gegenüberliegenden Flussufer Frauengelächter zu mir herüber, um im gleichen Augenblick wieder zu verstummen. Für einen Moment beneidete ich denjenigen, der der Frau dieses Lachen entlockt hatte. Eine Katze lief vor meinen Füßen über den Pfad, überschlug sich, und verschwand vom Entsetzen gepackt, im Ried.
„Heda“, drang eine heiser gedehnte Stimme vom Ufer zu mir her, „komm her!“
Ich beschleunigte meine Schritte. Auf der Wiese am Ufer, zerrte eine gebeugte Gestalt an irgendetwas.
„Hilf mir!“ rief der Mann fast im Befehlston, ohne mich anzublicken, dann begann er zu schimpfen, und schlug mehrmals auf die dunkle Masse ein, die vor seinen Füßen lag. Er stolperte, fiel aber nicht hin.
„Was macht er denn da…“, fragte ich mich, und ich fühlte am Ton meiner Stimme, dass mir der Mut zurückkehrte. Aber sobald ich nähertrat, erschrak ich da, da ich sah, dass der Mann auf einem anderen Mann zu sitzen schien.
„Ertrunken“, schoss es mir durch den Kopf, und ich wurde von jäher Furcht überfallen. Fast wollte ich umkehren, stürzte aber unwillkürlich nach vorn, auf die beiden Gestalten zu. Der Sitzende stand auf und begann an dem, der am Boden lag, unter Flüchen und Beschimpfungen herumzuzerren. Als ich neben ihm stand, musste ich mich erneut überwinden: Es schien mir, ich kenne den Mann.
Es war wohl der, der mir einmal in einer Siedlung in Tatarien begegnet war. Ich war dort, nachdem ich vergeblich eine Unterkunft gesucht hatte, in einem verlassenen, halb verfallenen Gebäude untergekommen und hatte mich zum Schlafen in eine Ecke verkrochen. Er hatte mich mitten in der Nacht aufgeweckt, und mir, als er erfahren hatte, dass ich Armenier war, geraten, sofort zu verschwinden, denn in jener Gegend seien die Armenier nicht gut angeschrieben. Hier sei es nachts nichts sicher, da hier ein Sammelplatz von Alkoholikern, Nutten und Drogenwracks sei. Er selbst sei zwar eine reine Seele und hielt die Armenier für ein gutes Volk, aber wir sollten uns lieber die Gurgel schmieren, und ich sollte mich anschließend aus dem Staub machen. „Also, was meinst du dazu?“, hatte er gefragt. Ich hatte ihn zunächst schlaftrunken angesehen und nicht verstanden, was er meinte. Mein Kopf war benebelt, als träumte ich noch. Er machte plötzlich eine finstere Miene und drohte, vor sich hin brummend, mit dem Finger. „Denk dran“, sagte er, „ich hätte dir das nicht sagen müssen. Ich hätte dich leicht ins offene Messer laufen lassen können, aber ich hatte Mitleid mit dir. Also, was ist?“ Da er auf seinem Vorschlag insistierte und dicht an mich herangetreten war, wühlte ich in meinen Taschen, drückte ihm die ersten besten Münzen in die Hand und sprang aus dem Fenster. Ich verließ die Siedlung, ging dabei so gut es ging den umherstreunenden Hunden aus dem Weg, indem ich mich durch dunkle, holprige und krumme Gassen vorwärtstastete. Ich fand mich in der Finsternis draußen in der riesigen Steppe wieder, wo ich mich unter einen Baum legte und sofort in einen traumlosen Schlaf versank. Am nächsten Morgen wurde ich wach vor unerträglichen Schmerzen im Rücken, halbtot…
„Kannst du nicht russisch“, röchelte er jetzt verärgert, wobei er mir den Kopf halb zugewandt hatte, während er versuchte, den anderen Mann aus dem Schlamm zu ziehen. „Hilf mir!“
Ich bückte mich, packte die Gestalt mit einer Hand am Gürtel und mit der anderen am Arm und begann, ihn aus dem Schlamm zu ziehen, doch es wurde mir übel vor dem Geruch billigen Weins, der mir entgegenschlug.
„Bist du schon mal in Tatarien gewesen“, fragte ich den Mann beiläufig, doch er schien nichts gehört zu haben, denn er schimpfte unaufhörlich weiter. Es fiel mir auf, dass er ebenfalls betrunken war. Ein älterer Mann mit einer flachen Nase und einem bärtigen Gesicht. Der am Boden lag, war ein junger Mann, höchstens Anfang zwanzig, mit, soweit ich das im Dunkeln erkennen konnte, regelmäßigen, schönen Gesichtszügen. Sein Körper sah aus wie ein Leichnam, schwer, schmutzig, stinkend und leblos. Seine Augen waren geschlossen, der Mund halboffen, nur sein Röcheln und die Muskelkrämpfe, die ihn schüttelten, verrieten, dass er noch am Leben war. Mich überfiel eine eigentümliche Starre. Ich bewegte mich wie in Trance, als hätte ich mein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als irgendjemanden aus dem Schlamm herauszuziehen… Endlich hatten der Ältere und ich den jungen Mann soweit aus dem Morast gezogen, dass nur noch seine Schuhe im Schlamm steckengeblieben waren. Meine Kleider und meine Hände waren schmutzig. Ich ärgerte mich, dass ich mir immer wieder solche Geschichten einbrockte.
„Du bist einer von den Armeniern aus dem Container…“, sagte der Alte, als fiele ihm jetzt erst ein, dass ich die ganze Zeit bei ihm war. Er versuchte, seinen Kopf gegen den Rücken des anderen zu stemmen, um die Hände freizubekommen und den Jungen unter den Armen fassen zu können, verlor dabei aber das Gleichgewicht, und beide fielen geräuschvoll ins Gras. Fast hätten die beiden auch mich zu Boden gerissen, aber ich hatte mich im letzten Augenblick befreit.
Der Alte stürzte unglücklich; er schrie jäh auf, fiel hin und begann sofort, sein Bein unter dem anderen hervorzuziehen und zu schimpfen. Schließlich stand er auf und begann wieder, dem Jüngeren Tritte zu versetzen. Dabei sprach er zusammenhanglos vor sich hin, hustete und spuckte. In seinem wirren Geschimpfe war von Seilen und Brotmessern die Rede und mehrfach von einer gewissen Marta Semjonowna. Ich fasste den Alten am Rücken und zog ihn auf die Seite. Zu meinem Erstaunen hielt er mir nun in wohlgesetzten Worten vor, ich schulde ihm eine Flasche armenischen Kognak, denn er habe, wie sich ausdrückte, „das Schicksal der Armenier“ gerettet: Er sei es gewesen, der sein Leben dafür eingesetzt hatte, dass die Tataren aus Fask unseren Wohncontainer nicht geplündert hätten. „Nein, ihr dürft die Armenier nicht antasten..!“ Ich setzte ihn auf dem Boden ab und versicherte ihm, dass es nicht nötig sei, sofort auf die Tataren loszugehen, um sie zu vernichten, sondern dass man einen günstigeren Zeitpunkt abwarten solle.
„Auch den Foka vernichten wir“, sagte er, „ihn vor allem, diesen Foka!...“
„Auch den Foka“, pflichtete ich ihm bei.
Einen Augenblick schien er sich beruhigt zu haben. Er hatte den Kopf in die Hände gestützt und schaukelte mit den Knien hin und dann. Dann versuchte er wieder über den am Boden Liegenden herzufallen, der mit dem Kopf im Gras lag und schnarchte. Ich versuchte den Alten zu beruhigen, er aber schluchzte und schüttelte den Kopf wie ein Irrsinniger. Er stimmte kurz ein Lied an, dann schlug er sich theatralisch an die Brust und begann eine dunkle Geschichte zu erzählen, der ich entnehmen konnte, dass der junge Mann sein eigener Sohn war, der seinen „leiblichen Vater hintergangen“ hätte, indem er ihm besagte Marta Semjonowna ausgespannt hätte, die doch ihm allein gehöre. „Ich kam gerade dazu, als sie sich küssten…“, sagte er und sparte nicht mit schmutzigen Details, von denen mir buchstäblich übel wurde, und der eben noch gefasste Entschluss, die beiden mit in unseren Container zu nehmen und in ein Bett zu stecken, löste sich in Luft auf...
„Ihr blöden Hunde! Man sollte euch... “, entfuhr es mir.
Ich besann mich, begann, nach meiner Wäsche zu suchen, die ich am Vortag auf dem Gras ausgelegt hatte, doch mein Hemd und die Unterwäsche mussten gestohlen worden sein, denn ich konnte nur noch eine einzelne Socke finden. Die ganze Zeit über hatte der Alte weiter geredet, er sprach aus vollem Hals und gedehnt, erwähnte irgendwelche alte und neue Rechnungen, Namen, Autoteile, einige Vorsitzende und andere Dinge. Ich nahm meine Socke und ging zum Pfad zurück. Als ich das Ried verließ, verstummte er. Vermutlich war er neben seinem Sohn zusammengesunken und schnarchte bereits…
Kapitel 3
Dass meine Sachen gestohlen worden waren, traf mich an einem wunden Punkt. Besonders betrübte mich, dass mein Hemd verschwunden war. Es war zwar schon blass und abgetragen, aber ich trug es sehr gern. Das Gefühl, dass ich dieses Hemd nie mehr anziehen würde, regte mich auf. „War das denn nötig!“ murmelte ich mürrisch vor mich hin, „alles verkehrt..!“. Ich wollte mir mit der Socke die Hände abwischen, überlegte es mir aber anders. Ich steckte die Socke in die Tasche, riss ein Bündel Gras aus und ging, während ich mir damit die Hände reinigte, zurück zum Container.
Das Licht aus dem Fenster fiel schräg auf den holprigen Boden. Man konnte die Steine und trockene Schlammklümpchen mit ihren formlosen länglichen Schatten klar unterscheiden. Der Gedanke, dass ringsumher menschenleere Steppe war, vor mir der finstere Fluss, über mir der dunkle Himmel, dass es, nur hier, wo ich jetzt stand, hell war, erfüllte meine Seele. Und ich fühlte mich einem Menschen nicht unähnlich, der gerade einer großen Gefahr entronnen war, und wurde von dem Wunsch gepackt, meinen Kameraden einen übermütigen Streich zu spielen. Kaum hatte ich mir etwas ausgedacht, um die Jungs zu erschrecken, hörte ich aus dem Innern des Containers die Stimme meines Altersgenossen. Ich hörte, wie mein Name fiel; ich hielt inne, setzte mich vorsichtig an die Türschwelle und begann zu lauschen. Den Blick hatte ich in die Finsternis gerichtet, wie ich es immer tat, wenn ich nachdachte, denn in der Finsternis wird alles deutlich.
„...nee, Bruder, das ist was anderes“, sagte mein Altersgenosse im Überschwang zum Berg-Karabacher, denn an den anderen, den Weichling, konnte er das Wort nicht gerichtet haben, er hatte für ihn nur Verachtung übrig. Er hielt den Weichling für einen Angeber und hielt ihm insgeheim die Schwächen vor, die er sich selbst gegenüber nicht eingestehen konnte.
„Er ist ein naiver Typ“, setzte mein Altersgenosse fort, „wenn er zum Beispiel eine Schlägerei beobachtet, geht er sofort dazwischen, um zu schlichten...“
Es ging also um mich, und ich zuckte unwillkürlich zusammen.
„Kurz gesagt, er ist kein gescheiter Kopf.“ Ich hörte sein Bett knarren, wahrscheinlich hatte er, während er über mich sprach, die Lage gewechselt. „Dabei denkt er gar nicht daran, dass sich zwei Streithähne auch rasch wieder versöhnen können, miteinander ein Gelage feiern, und er dann zwischen den Fronten steht und die Zeche bezahlen kann.“ Dann hörte ich, wie ein Streichholz angezündet wurde, kurz darauf ein Husten; wahrscheinlich hatte er sich eine Zigarette angezündet. „Wer weiß, Bruder, vielleicht bekommt er bei einer solchen Gelegenheit ein Messer in den Rücken, wer weiß schon genau, worum es bei solch einem Streit geht, und mit wem man es dabei zu tun hat? Hab ich nicht Recht?“ Er wartete die Antwort seines Gegenübers nicht ab, da er ohnehin davon ausging, dass er Recht hatte. Er schwieg eine Weile, dann lachte er hintergründig.
Jetzt versuchte der Weichling sich räuspernd in das Gespräch einzuschalten. Ich konnte nur einen Wortfetzen verstehen, der etwa „Gewissen“ bedeuten könnte, dann hatte mein Altersgenosse den Einwand des Weichlings beiseite gewischt und wieder das Wort ergriffen.
„Der Kerl redet Mist und kapiert überhaupt nichts.“ Er zog also, wie ich mir gedacht hatte, das Weichling auf. „Hör einfach nicht hin, lass ihn nur reden. Eines Tages wird er sich schon wieder melden mit seinem lästigen Geschwätz und dafür eins in die Schnauze kriegen...“ Der Weichling gab ein paar klägliche Protestlaute von sich. „Bruder, wir hatten einen Hund, der auch so gewinselt hat, aber als er kein Futter mehr hatte, ging er schließlich ein.“ Die Stimme meines Altersgenossen klang überheblich und hatte einen höhnischen Unterton.
Ich saß auf meinem Platz und lächelte vor mich hin, denn gleich würde das Theater beginnen. Mein Altersgenosse demütigte den Weichling als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, und der Weichling versuchte, um der Sache die Spitze zu nehmen, alles ins Lächerliche zu ziehen, oder er versuchte, Verwirrung zu stiften, indem er zusammenhanglose Bemerkungen machte. Aber diesmal schwieg er, der Ton meines Altersgenossen klang ernst und bedrohlich. Ich empfand kurz Mitleid mit dem Weichling, während ich mir seinen hilflosen Gesichtsausdruck vorstellte.
„Dass bei uns augenblicklich alles schief läuft, Bruder“, rief mein Altersgenosse erhitzt, „ist auch seine Schuld. Du kannst ihm alles erzählen. Er steht in der Gegend rum und hält Maulaffen feil.“ Offensichtlich ahmte er mich nach, während er das sagte, und lachte dabei. „Die sind so geeicht, die glauben einfach an alles, Bruder, seine Familie ist halt so. Von Anfang wusste ich, dass mit dem nicht viel Staat zu machen ist, Kumpel. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, in der Gegend dort war nicht viel zu holen, also sagte ich mir, komme, was wolle, ich geh mit ihm nach Russland, um ein bisschen zu verdienen, weil man, wenn man immer nur Herden hütet, keinen Schnitt machen und nichts auf die Seite legen kann.“ Er hustete. „Weiß der Kuckuck, wohin ich hier geraten bin!“ seufzte er. “Letztes Jahr saß ich um diese Zeit auf dem Berg Berdassar. Das war in Ordnung, jedenfalls ließ ich mir keine grauen Haare wachsen.“ Wieder hörte ich, wie ein Streichholz angezündet wurde. „Zum Beispiel, Bruder, was sollte das, als er dich heute anschrie?“ sagte er plötzlich und gab damit dem Gespräch eine neue Wendung. „Glaubst du, Iwanytsch hat nichts verstanden? Doch, er hat alles sehr gut kapiert... Statt den Chef bei Laune zu halten, spielt er sich selbst als Chef auf... Mach nur so weiter! Wir werden am Ende sehen, wie du aus der Situation heraus kommst.“ Bei den letzten Worten, mit denen er offenbar mich meinte, war er ärgerlich geworden. „Was wird er dir zum Beispiel zur Antwort geben?“ wandte er sich jetzt wieder an den Berg-Karabacher. Es war unverkennbar, dass er ihm schmeicheln wollte, doch der Berg-Karabacher schwieg. Er stimmte weder zu noch widersprach er. Wahrscheinlich hatte er, wie gewöhnlich, überhaupt nicht zugehört, denn der Berg-Karabacher wirkte meist abwesend, in irgendwelche Gedanken versunken, die im Dunkeln blieben.
„An meiner Stelle, Bruder, ich würde es nicht auf diese Weise tun“, sagte mein Altersgenosse. „Letztes Jahr... das müsste dir bekannt vorkommen, wird in eurer Gegend genauso sein: die reichen Typen aus der Stadt fahren regelmäßig mit schönen Frauen raus in die Berge. Wenn man sie sieht, denkt man, sie seien unberührt – richtige Schönheiten, bildschöne Frauen“, sagte er und dehnte dabei lustvoll jedes einzelne Wort. „In irgendeinem Gebüsch, im Schoß der Natur lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf und verschaffen sich Erleichterung. Pflücken Blumen und fahren wieder nach Hause. Einmal saßen mein Freund und ich oben auf dem Gipfel des Berdassar. Die Herde weidete vor sich hin, wir saßen, Rücken an Rücken, und pfiffen abwechselnd vor uns hin. Plötzlich sehen wir das Heck eines Wagens langsam in ein Gebüsch reinfahren. Zuerst steigt ein graumelierter Bulle aus, dann geht auf der anderen Seite die Tür auf und es erscheint ein blutjunges Reh... Was soll ich sagen? Es war, als ginge die Sonne auf...“
„Wieso kann ein Reh ins Auto steigen?“, fragte der Weichling ironisch. „Das ist doch glatt erfunden!“
„Du bist noch zu grün dafür. Dir fällt kein Zacken aus der Krone.“
„Mit dem Zacken würde ich dir in die Krone fahren und nach Amerika fliehen...“
„Na gut, nächstes Jahr, wenn es Frühling wird, nehme ich dich mit zu meiner Herde, damit du es mit deinen eigenen Augen siehst... Also mein Freund sagte zu mir: ‚Komm, wir ziehen ihm eins über, der steht doch bereits mit einem Fuß im Grab, aber guck doch mal, was er da treibt!‘ Ich sagte mit so einem Grinsen: ‚Bis du blöd, Mann? Natürlich gehen wir hin, aber wir machen was anderes.‘ Wir gingen rüber. Mein Freund zog ständig an meinem Rücken und sagte, das sei langsam ungemütlich, wir sollten umkehren. Ich aber ging auf den Mann zu und sagte in einem Ton, wie man in Filmen spricht, also so ungefähr sagte ich: ‚ Hallo, Chef, ein Ausflug in den Schoß der Natur, was?‘ Der Mann sah uns an, lief rot an, als hätte ihm einer einen Eimer kaltes Wasser übergeleert. Ich sagte: ‚Keine Angst, Chef, ich kann Sie gut verstehen.‘ Er war offenbar ein Schlappschwanz. Er stand sprachlos da, während ich den Knüppel in der Hand drehte.“ Er sagte: ‚Wir suchen nach Menschenknochen, wir sind Archäologen.‘ Ich sagte: ‚Ach ja? Und die Dame ist wohl Ihre leibliche Tochter?‘ Er war verblüfft und wurde abwechselnd rot und blass. Ich sagte: ‚Chef, das war ein Scherz. Obwohl wir viel hauptsächlich mit Viehzucht zu tun haben, sind wir schon ein bisschen herumgekommen und verstehen etwas von den angenehmen Seiten des Lebens, wir sind auch nicht von gestern.‘ Er wirkte erleichtert und beeilte sich zu sagen: ‚ Ihr seid tolle Kerle, mir scheint, mit euch könnte man was losmachen. Ehrlich gesagt, Jungs, bin ich kein Archäologe, sondern ein Dichter, mein Name müsste euch ein Begriff sein – Kostan Wardanyan.‘ Ich sagte: ‚Schön für Sie, dass Sie ein Dichter sind, Chef, aber hier hat jeder Stein, jeder Busch tausend Augen; letztes Mal kam einer vorbei, der auch wie sie so ein Vögelchen hierher gebracht, und dann, als er wegfahren wollte, verlor er doch noch...‘ Der Mann schüttelte ungläubig den Kopf, sah mich an und fragte: ‚Wieso verlor er?‘ Ich sagte: ‚Das ist ganz leicht zu erklären, Chef. Er ging durchs Feuer, eines dieser tausend Augen nahm ihn unter Feuer...‘ Der Mann verstummte, sagte ‚Hm‘ und steckte plötzlich seinen Kopf ins Auto und holte zwei funkelnagelneue vierfarbige Kugelschreiber und zwei Feuerzeuge heraus und gab sie mir. Ich sagte: ‚Okay, Chef, ich habe Sie verstanden. Ich wünsche gute Verrichtung. Komm, Mann, wir gehen...‘“
Mein Altersgenosse hielt einen Moment inne, wahrscheinlich um den Eindruck zu prüfen, die seine Geschichte auf die anderen gemacht hatte. Aber er konnte nicht zufrieden sein, denn niemand reagierte. „Was will ich damit sagen…“, begann er unsicher. „Der Mensch soll ja eine feine Nase haben, wie es heißt. Also schau her, Bruder, ich brauchte nur ‚Feuer‘ zu sagen, und der Mann kapierte sofort, dass es um Feuerzeuge geht…“, lautete die etwas mühselige Erklärung. „Den Kugelschreiber bekam übrigens mein Sohn, damit er mit ihm herumkritzeln konnte...“
„He, du!“, rief der Weichling und klatschte dabei in die Hände. „so eine blödsinnige Geschichte. Ja! Der erzählt, er hat nur ‚durchs Feuer‘ gesagt, und der andere gibt ihm zwei Feuerzeuge...“
„Was schreist du hier rum wie ein streitsüchtiges Weib?“, sagte mein Altersgenosse. „Und überhaupt, was geht es dich an?“
„Du hackst auf diesem Typ rum“, sagte der Weichling ernst, „dabei hat er doch alles in seine Kräften liegende getan.“
„Ich rede kein Blech, du Blödmann“, sagte mein Altersgenosse aufbrausend. „Es reicht nicht, das Übliche zu tun. Man sollte das Unmögliche tun, sonst das Mögliche kann ein jeder tun… Du musst mehr bringen als die anderen und was riskieren, wenn du ihnen zeigen willst, wo es langgeht.“
„Dann spiel du doch den Chef!“, erwiderte der Weichling. „Stell dir vor, du bist der Chef. Wie würdest du dich verhalten? Würdest du Iwanytsch hinterher laufen und ihn einschmeicheln? Wie würdest du es anstellen, die anderen auf deine Seite zu ziehen?“ Die letzten Worte hatte er mit Nachdruck und einem ironischen Unterton gesagt. „Und darüber hinaus… bist du selber Dummkopf!..“
Zu meinem Erstaunen sagte mein Altersgenosse zunächst nichts; er erwiderte selbst dann nichts, als er meiner Meinung nach längst etwas hätte sagen müssen. Er setzte mehrmals an, aber irgendetwas hinderte ihn daran zu reden. Es klang, als reiche sein Atem nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass er sich einfach seines Lebens freute und dass es diese Freude war, die ihm die Sprache verschlagen hatte. Endlich erklang wie zur Bestätigung meiner Vermutung sein befreiendes Lachen. Dieser Eindruck ging mir so nahe, dass ich augenblicklich beschloss, dass er von nun an unser „Chef“ sein sollte... Und der Weichling war still geworden. Seine Aufrichtigkeit kam mir unerwartet vor, und ich war ihm dankbar, dass er mich verteidigt hatte. Ich beruhigte mich. Mir wurde leicht ums Herz, weil sich, wie mir schien, plötzlich alles aufklärte, das, was unklar und dunkel geblieben war, lag mit einem Mal offen zutage. Nun fühlte ich mich endlich von dieser Last befreit und atmete auf.
„Schluss…“, flüsterte ich vor mich hin. „Dies ist auch vorbei…“.
Aber in dem Augenblick, in dem meine Stimme in meinen Ohren verklang, überfiel mich plötzlich ein finsteres Gefühl des Entsetzens, und wurde mir auf einmal klar, dass das nicht möglich war. „Wieso?“, dachte ich bei mir, „wieso musste ich monatelang hungrig und durstig durch diese verlassenen Steppen ziehen, mich vor diesem und jenem erniedrigen, um eine Arbeit zu finden, damit es auf dieses trostlose Ende hinausläuft..!“
„Auf keinen Fall!...“, zischte ich vor mich hin, und ich verlor beinahe die Fassung, als sich mir die Szene wieder aufdrängte, die ich in der Verwaltung eines verlassenen Nestes einmal erlebt hatte: wie der dortige Gemeindevorsteher plötzlich in Wut geraten war wegen eines Mannes, der in seltsamer, vor Schmutz starrender Kleidung und mit über die Augen gezogener Mütze in erstaunlicher Gelassenheit vor ihm stand. Ich erinnerte mich, wie der Gemeindevorsteher, als er mich erblickte, die Beherrschung verlor, mit dem Fuß auf den Boden stampfte und mir die Tür wies und, als ich mich ihm widersetzte und ihn bat, mir nur einen einzigen Augenblick lang zuzuhören, als Antwort den Aschenbecher nach mir warf. Ich hatte mich damals mit Mühe und Not aus dem Staub gemacht und dabei noch beobachtet, wie er, während er aus seinem Arbeitszimmer hinter mir herrannte, seine Sekretärin anschrie, dass er sie immer wieder davor gewarnt hätte, keinen dieser schmutzigen Schwarzhaarigen in sein Büro zu lassen..!“
Verwirrt von der Erinnerung an dieses Erlebnis, das schon eine Weile zurücklag, aber in diesem Augenblick wieder lebendig vor mir stand, spürte ich, wie plötzlich wieder der Hass gegen meinen Altersgenossen in mir aufstieg, plötzlich, unabweisbar, wie eine unverrückbare Tatsache, die nicht das Geringste mit mir zu tun hatte. Ich stand auf, um den Wohncontainer zu betreten, damit alles wieder seinen gewohnten Gang ginge. Aber im selben Augenblick setzte ich mich wieder. Aus dem Innern des Containers drang plötzlich die ruhige, wie aus einer großen Tiefe kommende Stimme des Berg-Karabachers.
„Ihr redet so daher und freut euch, aber, wenn mir einer mit dem Messer in mein Herz stechen würde, käme kein Tropfen Blut heraus... ich werde verrückt... ich bringe mich um ... ich halte das alles nicht mehr aus...“
„Was redest du da“, fragte der Weichling ängstlich, oder… sagst du ein Gedicht auf?“ Mit dieser Bemerkung versuchte er vermutlich, seine Verlegenheit zu überspielen, doch der Berg-Karabacher antwortete ihm nicht.
„Er sagte, dass meine Mutter verrückt geworden sei, meine liebe Mutter“, sagte der Berg-Karabacher mit gebrochener Stimme. „Er sagte, meine Mutter hätte das Essen vor Arams Bild gelegt und zu ihm gesagt, ‚Iss, mein Sohn, du hast doch heute noch nichts gegessen.‘“ Ich hörte am Ton seiner Stimme, dass er weinte. „... du hättest nicht hinsehen sollen ... du hättest mit geschlossenen Augen vorbeigehen sollen“, schluchzte er.
„Wer ist Aram? Ist er dein Bruder“, fragte der Weichling verständnisvoll. „Du hast uns doch gesagt, du hättest keinen Bruder“, fügte er neugierig hinzu.
„Er war doch in der Armee, als man auch mich einberufen hatte“, sagte der Berg-Karabacher mit einer dünnen Stimme, der man den Schmerz, den er empfand, anhören konnte. „Oh nein, liebes Aschchen!.. Oh, liebe Mutter!..“ Er sagte etwas in seinem Dialekt, das ich nicht verstand. Er redete bereits wie im Fieber. „Nein, ich werde nicht nach Hause fahren ... ich nehme mir das Leben ...“
„Bist du verrückt geworden?“, rief mein Altersgenosse wütend. „Du bist ein Mensch, also benutze deinen Verstand und drück dich so aus, dass wir dich verstehen... Dreh dich gefälligst um, wenn ich mit dir rede...“ Er ging offenbar auf den Berg-Karabacher zu und begann, ihn zu schütteln. „Anstatt mit mir zu reden, siehst du die ganze Zeit diesen Dummkopf an. Was versteht er schon? Der kann dir doch auf nichts eine vernünftige Antwort geben.“ Offensichtlich passte ihm nicht, dass der Berg-Karabacher sich nicht an ihn gewandt, sondern den Weichling angesprochen hatte.
„Lass, lass mich“, sagte der Berg-Karabacher und legte, um sich zu fassen, eine kurze Gesprächspause ein. Dann begann er, zunächst mit zitternder, dann aber immer mehr beruhigter Stimme zu erzählen.
Es stellte sich heraus, dass er am Tag unserer Ankunft, als man uns zu einem abgelegenen Güterbahnhof brachte, wo wir Waggons mit Backsteinen abladen sollten, seinen Dorfgenossen gesehen hatte, der ebenfalls seinen Militärdienst in dieser Gegend ableisten musste. Er hatte ihn getroffen, während er im Laden Zigaretten kaufte. Der andere war überrascht, ihn hier anzutreffen. Als der Berg-Karabacher ihm gesagt hatte, dass er nicht die Absicht habe, nach der Zeit beim Militär nach Hause zurückzukehren, hatte der andere ihm erzählt, was seinen Angehörigen inzwischen zugestoßen war.
Er erzählte ihm, dass sein Bruder Aram wohlbehalten von der Armee nach Hause zurückgekehrt sei und zum Dorfhirten geworden war. Einmal, als er in der Abenddämmerung die Herde ins Dorf zurückgetrieben hätte, hätte er vom Waldhang aus beobachtet, dass sich irgendwelche Leute im Friedhof des Dorfes, der etwas außerhalb an einem schattigen Platz lag, zu schaffen machten, und zwar genau an der Stelle, an der seine frühverstorbene Schwester Aschchen begraben war. Beunruhigt sei er zum Friedhof gelaufen und hätte gesehen, dass es sich um Türken aus dem Nachbardorf gehandelt hätte, und dass es tatsächlich das Grab der Schwester war, und dass einer der Türken auf der Grabstätte gekniet hätte...
Der Berg-Karabacher begann an dieser Stelle seiner Erzählung wieder zu weinen, brachte es aber nicht über die Lippen zu sagen, was die Türken mit dem Grab der Schwester gemacht hätten, schluchzend sagte er nur „das Bild...“
Drinnen herrschte ein bedrückendes Schweigen. Kein Ton, kein Gedanke, nichts. Auch ich war entsetzt, aber da war noch etwas anderes, ein undeutliches Gefühl, weit weg von mir, das allmählich von mir Besitz ergriff. Ich war froh, froh, in diesem Augenblick hier draußen zu sein, während ich mir fieberhaft den Ellbogen kratzte, und nicht drinnen bei den anderen und das Gesicht des Berg-Karabachers sehen musste. Es schien mir, dass etwas Schreckliches passieren können, wenn ich gezwungen gewesen wäre, ins Gesicht des Berg-Karabachers zu sehen, etwas Furchtbares, das uns alle in den Abgrund hätte ziehen können. Und ich fing an, wütend zu werden auf den Berg-Karabacher und darauf, dass er diese Geschichte erzählt hatte. Ich hasste ihn dafür, dass er da war, genauer gesagt, hasste ich das Gefühl, mit ihm, seiner Gegenwart konfrontiert zu sein... Plötzlich schoss mir ein übler Gedanke durch den Kopf, und während ich mich an diesen Gedanken klammerte, hatte ich das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen. „Kann es sein“, dachte ich bei mir, „dass er das alles nur jetzt erzählt hat, um sich von dieser aussichtslosen Situation, die wir erleben müssen, befreien und weggehen zu können? Er bereut es offensichtlich, dass er sich uns angeschlossen hat. Er hasst mich... bestimmt...“ Ich fühlte, dass ich ihm damit Unrecht tat, aber mir fielen all die Kleinigkeiten ein, die er sich hatte zu Schulde kommen lassen. Ich suchte nicht nach Gründen, ihn zu entschuldigen, im Gegenteil, ich kramte aus unserem Zusammenleben hier alle möglichen Details hervor, die ihn belasten, anklagen sollten. Ich türmte die Fakten auf und baute sie zu einem großen Anklagegebäude aus. Ich war ganz beschäftigt mit dieser sinnlosen Arbeit, als ich die Stimme des Weichlings vernahm.
„Dann?“, fragte der Weichling leise. „Und weiter?“
„Was dann?“, unterbrach ihn mein Altersgenosse wütend, „was soll das heißen: was dann?“ Dann fuhr er hart trocken fort. „Ist dir nicht klar, dass die Türken den Kopf seines Bruders mit einem Stein zermalmt haben?“ Seine Stimme nahm der Ton der Anklage an, als sei der Weichling schuld an dem, was passiert war. Dann schien er sich wieder dem Berg-Karabacher zuzuwenden. „Warte mal, warum hast du es bis jetzt vor mir verheimlicht?“ Seine Stimme klang vorsichtig und vorbehaltsvoll. „Hättest du uns rechtzeitig was gesagt, hätten wir etwas unternehmen können“, sagte er vorwurfsvoll. „Wir hätten Geld sammeln und dich damit nach Hause schicken können...“
„Und wer sollte die Uhr kaufen?“, fing der Weichling zu sticheln an. „Die arme Russin...“
„Warum hast du nicht früher Bescheid gesagt?“, wiederholte mein Altersgenosse. Seine Stimme klang jetzt kalt und ruhig.
„Ich hatte Angst“, entgegnete der Berg-Karabacher schluchzend, „ich hatte Angst...“
„Wovor?“, fragte mein Altersgenosse herablassend. „Hat in meiner Anwesenheit irgendjemand je ein böses Wort über dich verloren?“ Er sprach beinahe mit der Weisheit eines Alten, und mir schien, dass er mit diesen Worten sowohl den Berg-Karabacher als auch sich selbst hochnehmen wollte.
„Wie sollte ich es sagen... Hätte ich es ausgesprochen, ich wäre verrückt geworden, wenn es ein anderer erfahren hätte...“, antwortete der Berg-Karabacher mit schwerer Stimme. „Es stellt sich heraus, dass ich der Mörder meines eigenen Bruders Aram bin“, sagte er traurig. „Ich bin da, er aber ist nicht am Leben; das heißt, ich bin schuld... Wie soll ich meinen Eltern ins Gesicht sehen?“ Seine Stimme zitterte. „Was soll ich tun“, sagte er hastig. „Nein, es hat keinen Zweck. Es ist alles im Wald verloren gegangen...“
Er wechselte die Tonart und begann, in seinem Dialekt schnell vor sich hin zu sprechen. Von seinen Worten verstand ich fast nichts. Wie sehr ich mich auch bemühte, das wenige, was ich verstand, miteinander in Zusammenhang zu bringen, es gelang mir nicht, ihn zu verstehen. Er sprach hastig und wirr, wie in einem Fiebertraum: irgendwelche Geschichten, unklar und zusammenhanglos, es ging um verlorene Kühe, über die Schuhe des Bruders und wieder um Kühe, dann tauchten irgendwelche Soldaten auf, die ihn geprügelt hätten oder die er geprügelt haben wollte, dann fiel er über seinen Vater, seine Mutter und die Verwandten her, er beschuldigte sie, machte ihnen Vorwürfe, schimpfte lauthals, zwischendurch sprach er immer wieder mit besonderer Zärtlichkeit den Namen seines Bruders Aram aus, dann begann er sich selbst zu beschimpfen, schließlich erstickte seine Stimme, er hustete, verstummte kurz und fing zu weinen an...
Ich zog mich zusammen, in meinem Innern nahm ein Gefühl langsam die Form eines Gedankens an, den ich, als ich ihn erfasst hatte, in meinem Inneren ständig wiederholte: „Wir haben eine gemeinsame Sprache, verstehen einander aber nicht. Wir leben unter einem Dach, kennen einander nicht...“ Und plötzlich stellte ich mir mit lebhaftem Vergnügen in allen Einzelheiten vor, wie Aram, der Bruder des Berg-Karabachers gegen die Türken gekämpft hatte, und wie die Türken ihn schließlich ermordet hatten... Ich fühlte mich seltsam erleichtert und gab mir Mühe, mich daran zu erinnern, ob der Berg-Karabacher selbst von dem Mord gesprochen hatte, konnte mich aber nicht entsinnen. Meine hilflose Bemühung erweckte in mir jenen hilflos-verzweifelten, kläglichen und verdutzten Blick des Berg-Karabachers auf, als er, das Hemd in der Hand, gestanden hatte und wusste nicht, ob er zu Iwanytsch gehen sollte oder nicht; in diesem Augenblick war in seinem gesamten Äußeren und in seiner Haltung eine tiefe Verlegenheit; und nun belebte sich vor meinen Augen wieder sein Blick, nur der Blick, ohne die Augen und das Gesicht, wie von einer Unschlüssigkeit umgeben. Ich begriff, dass jene Klangfarbe seiner Stimme, mit der er kurz zuvor wie im Traumfieber durcheinandersprach, ähnelte irgendwie dieser Unschlüssigkeit. Das machte auf mich einen unerwarteten Eindruck; es schien mir, damit hätte sich auf einmal etwas sehr Wichtiges geklärt, aber ich konnte nicht verstehen, was nämlich, denn die Stimme meines Altersgenossen kam dazwischen. Sie klang dermaßen besorgt, dass sie mir einen Augenblick ganz fremd vorkam.
„Weißt du, was du zu tun hast?“ Mein Altersgenosse sprach langsam, Wort für Wort. „Weißt du, was du zu tun hast?“ wiederholte er. „Du fährst nach Hause, meinetwegen auch morgen, du fährst also nach Hause, erfährst alles Punkt um Punkt, dann gehst, findest diese zwei Mörder und bringst die beiden einzeln um...“
„Er hat so einfach sie fertig gemacht und tschüs... ja?“, unterbrach ihn der Weichling empört. „Was könnte damit erreicht werden, du Dickkopf?.. Man würde ihn fassen, im besten Fall ins Gefängnis stecken, lebenslänglich... Und das sollte das Gewinn sein?“ spottete er. „Und wie sollte es mit den Eltern dieses Menschen weitergehen?..“ In der Stimme des Weichlings war Entsetzen zu hören: wahrscheinlich versetzte ihn der bloße Gedanke des Tötens und Getötet Werdens in den Schrecken, sonst hätte er nicht immerfort wiederholt: „Das nenne ich Verstand!... Das nenne ich Versand!...“
„Du brauchst keine Angst zu haben... Fürchte dich nicht!“, sprach wieder mein Altersgenosse. Er ignorierte dabei offensichtlich den Einwurf des Weichlings. Seine Stimme war erstaunlich ruhig, versöhnlich und mit so einer tiefsinnigen Trauer erfüllt, die man von ihm nicht hätte erwarten können. „Sieh, du sagst, du bist nicht imstande, jemandem etwas Schlechtes zu tun…“ Der Berg-Karabacher hatte so etwas nicht gesagt. „Du denkst falsch... das brauchst du nicht...“ Mein Altersgenosse sprach wie zu sich selbst; es war ein seltener Augenblick der Aufrichtigkeit und ich war ganz Ohr. „So, Bruder, mein Vater quälte sich seit der Kindheit in Schmutz und Schlamm. Dann wurde er bei der Arbeit wegen einer unglücklichen Handbewegung von einem Zahnrad hineingerissen, fiel in die Dreschmaschine hinein... und wurde zermalmt... Er hinterließ sechs arme Waisen und ging dahin... Du sagst, die Welt!... Man kam von oben, stell dir vor, man wollte auf jede Weise uns schaden, man wollte keine Rente zuschreiben; man meinte, er wäre betrunken gewesen," mein Altersgenosse hob bedrohlich die Stimme. „Während, Bruder, nahm der arme Mann keinen Tropfen in den Mund, Leber, Magen machten ihm starke Schmerzen; das eine Auge hatte der Stier vor paar Jahr ausgeschlagen, zerstört... Ach, mein lieber Vater!...", brüllte er. "Es gab einen, unter den Beamten gab es einen, einer mit so einem Kuhkopf, mit Brille, so als wenn die Kuh eine Brille tragen würde, besonders der war heftig dagegen. Nach langem Hin und Her nahm mich einer von denen zur Seite, er sagte mir: „Erhitze dich nicht, dieser Mann mit Brille ist sehr gütig, wenn du ihm was gibst, so wird er schreiben...”. Mein Altersgenosse erhob seine Stimme immer mehr und mehr. „Ich fuhr in die Stadt, zu deren Vorgesetzten, nun lässt mich eine gefärbte Frau nicht rein, sie sagt: „Geh, zieh dich ordentlich an, rasiere dich...“. Und ein anderer von der Seite meinte: „Geh jetzt, komm in einem Monat wieder, der Chef ist nicht da!“. Das Blut schoss mir in den Kopf. Ich habe diese Frau beiseitegeschoben, um hineinzugehen und jetzt hat sich dieser Helfershelfer eingemischt, er hat die Tür geschlossen, lässt mich nicht rein; ich hab ihm eine verpasst und er gesellte sich zu den zehn Jahre alten Verstorbenen... Ich bin reingegangen, Bruder, habe ohne Zögern das Messer vor diesen Chef gehalten, gesagt: „Ich werde deine Eingeweide herausreißen... Du sollst schreiben… Du sollst schreiben… Du sollst schreiben...“. Mein Altersgenosse verlor anscheinend den roten Faden. "Was sagte ich?", kam er plötzlich zu sich. "Ich hab’s vergessen...“. Er wurde verlegen und schwieg.
Ich war stark enttäuscht. Alles hatte sich auch in Wirklichkeit so zugetragen, aber im letzten Teil der Geschichte, indem mein Altersgenosse erzählte: „Ich ging“ u. s. w., war alles frei erfunden, eine bloße Lüge. Er war nirgendwohin gegangen, oder auch gegangen, aber nicht reingegangen (man hatte ihn nicht reingelassen), war mit den vermischten Gefühlen nach Hause zurückgekommen. Nachts hatte er sich im Bett unruhig hin und her gedreht und, halblaut die Ordnung der Welt schimpfend, alles erfunden. Dann war er morgens geneigten Kopfes seinen Hirtenstab wieder in die Hand genommen und seine Herde in die Berge getrieben… Oder, wenn wir einen Augenblick, nur einen einzigen Augenblick annehmen würden, dass alles auch so geschehen war, wie er geschildert hatte, so wäre er jetzt in diesem Moment nicht hier, sondern in einer entsprechenden Anstalt...
„Die Tatsache ist, dass der Türke und die Maschine gleich sind“, schlussfolgerte unerwartet der Weichling.
„Gib mir eine zum Rauchen“, sagte bitter mein Altersgenosse, sich an den Berg-Karabacher wendend.
Kapitel 4
Ich stand auf. Die Finsternis war noch dichter geworden; der Fluss, die Riede, die Steppe, der Himmel waren voneinander nicht zu unterscheiden, alles war in eine undurchdringliche und grenzenlose Dunkelheit versunken. In meinem Innern herrschte die gleiche Dunkelheit, blind, gleichgültig, teilnahmslos. Es war mir, als wäre außer Dunkelheit nichts anderes möglich. Es war mir, als würde ich bei geringster Bewegung in den Abgrund hinunterpurzeln... Plötzlich überkam mich unendliches Entsetzen, und einen Augenblick lang verspürte ich die absolute Stille… Ein verirrter Nachtkäfer schlug stürmisch gegen meine Stirn und stürzte in die bodenlose Schlucht, dann hörte ich von der Seite, wo eigentlich der Fluss sein sollte, etwas einige Male gluckern: „Die Fische“, sagte ich unaussprechlich erfreut, „sie fangen Mücken ein“. Ich spürte, dass mein Inneres sich zu beleben begann und blickte auf das Containerfenster zurück.
Zahllose Insekte stürmten in Schwärmen und einzeln sinnlos gegen die Fensterscheibe und durch das Glas gegen das Licht. Mit gewaltiger Mühe stiegen sie bis zu einem bestimmten Punkt hinauf, dann fielen sie auf einmal hinab. Mit beneidenswerter Inbrunst nahmen sie den Angriff erneut auf und stürzten immer wieder hinunter. Mir fiel ein großköpfiges glänzendes Insekt auf, das für sich allein langsam am Scheibenrand hinaufkletterte, schwer, unerschütterlich und konzentriert. Seine schwersinnige Ernsthaftigkeit kam mir lächerlich vor. Ich lächelte und wurde unversehens von derartig verzehrender heftiger Sehnsucht nach Zuhause, Leben und Liebe gepackt, dass mir beklommen wurde...
Hinter dem Container raschelte es stark in den Rieden, ich spitzte die Ohren, dann kam eine junge dunkle Frauenstimme: “Oh! ich bin ganz nass...”, den Rest verschlang das Rascheln. Eine dünne ironische Männerstimme sagte lässig dazu: ”Macht nichts, zu Hause wäschst du dich und bist wieder in Ordnung”. Und Rascheln von neuem. Der Mann spielte offenbar auf etwas anderes, Hintersinniges, an, worauf vorwurfsvolles, fröhliches Gelächter der Frau erschallte, das mir bekannt erschien: Es war dasselbe Gelächter, welches ich damals gehört hatte, als ich zum Fluss hinunter ging. Ich machte ein paar Schritte in die Richtung, aus der die Stimme kam, hielt inne und starrte die Schilfe an. Das Rascheln hörte auf, eine Zeitlang war es still, dann drang ein Geflüster zu meinem Ohr; der Mann und die Frau waren anscheinend stehen geblieben und sprachen leise miteinander.
„Nein, du bleibst hier!..“, hörte ich endlich die Männerstimme sagen, aber erstaunlicherweise nicht dort, wo ich sie vermutet hatte, sondern in gegenüberliegenden Schilfen. Die undurchsichtige Schilfwand ging jählings auf, jemand kam im hellen Hemd heraus, schüttelte die Kleider ab und näherte sich. Das war ein mittelgroßer junger Kerl mit langem Hals, mit lässigen Bewegungen eines sorglosen Menschen.
„Gruß ans armenische Volk!“, sagte er mit falscher Innigkeit und wohl mit Spott aus einer Entfernung von ein paar Schritten. „Bei euch in der Gegend ist es ziemlich hell, und da will man noch behaupten, dass die Armenier...“, er brach sofort ab, um sich vielleicht nicht zu verplappern. „Na, Kollege, man schuftet und schuftet, doch des einen Tod sei des andern Brot, was?“ Er näherte sich mir und schüttelte mir die Hand:
„Wie geht’s?“
Ich betrachtete aufmerksam sein Gesicht: er war höchstens 20-22 Jahre alt, seine Gesichtszüge und sein irgendwie scharfer tückischer Blick deuteten darauf hin, dass er höchstwahrscheinlich ein Tatare war oder...
„Wie letztes Jahr“, entgegnete ich trocken.
Etwas bestürzt sah er mich fragend an; so eine Antwort habe er wohl nicht erwartet. Er wandte den Blick ab und hielt sich sicherlich am ersten besten Einfall fest: Er sagte, er hätte immer den Wunsch gehabt, uns zu besuchen und kennen zu lernen, doch es hätte nie geklappt, er bedauere das zutiefst und entschuldige sich dafür vom ganzen Herzen; jetzt aber verspreche er, einmal unbedingt mit seinen Freunden vorbeizukommen, eine Gelage zu feiern usw. Er sprach sehr schnell und ohne Atem zu holen, aus irgendeinem Anlass erzählte er einen Witz, den ich nicht verstehen konnte, dann irgendwelche Abenteuer von ihm und von seinem armenischen Freund, den er, ohne dass es ihn einen Groschen gekostet habe, von Gerichtsstrafe abgesehen hätte; und dann fügte er nach einer kurzen Pause hinzu, Iwanytsch sei ein guter Freund von seinem Vater, und obwohl er persönlich nicht gut zu seinem eigenen Vater stehe, werde er doch dem Vater sagen, er solle dem Iwanytsch sagen, dass dieser uns gut behandle... Während er sprach, machte er seltsame Bewegungen in der Luft: er ging langsam rückwärts, dann verbeugte er sich leicht taumelnd nach vorn und nach den Seiten, doch er war nicht betrunken und all die Zeit waren seine Schlitzaugen unentwegt und konzentriert. Ich sah ihm ins halbfinstere Gesicht, und es kam mir plötzlich merkwürdig vor, dass irgendein Mensch da steht und plaudert... Ich trat unruhig von einem Bein aufs andere, er bat mich um eine Zigarette und machte etwas, was ich nicht erwartet hatte und was mich nahezu beleidigte und erzürnte: Er bat mich schmeichlerisch um Verzeihung, dass er mich gelangweilt habe und, während er Abschied nahm, drehte er sich um und machte paar Schritte, dann schlug er sich plötzlich gegen die Stirn, sagte, beinahe hätte er vergessen, kam zurück, stellte sich fest mir gegenüber und verlangte einfach mit erstaunlichem Hochmut und Arroganz, ich solle ihm eine Flasche armenischen Kognak geben.
„Haben wir es nicht“, wies ich schroff ab, „gibt’s nicht“.
„Das Kind meines Freundes ist im Krankenhaus“, log er auf Anhieb, „ich soll es dem Arzt bringen, ich habe es versprochen...“, sprach er deutlich und feindselig sicher Wort für Wort aus, indem er seinen Blick drohend an mein Gesicht heftete.
Kaum wollte ich meine Absage wiederholen, als die Rieden erneut raschelten und eine junge Frau erschien. Sie kam langsam, fraulich sicher auf uns zu. Ihre Kleidung war tatsächlich nass, weil sie an ihrem Körper klebte und im Halbdunkel ihre Hüften, nackte Schultern und den unnatürlich vollen Busen umriss. Ich fühlte mein Herz pochen und mein Gesicht sich im Dunkeln röten. Sie trat dicht heran und indem sie sich leicht auf den Arm des jungen Mannes stützte, richtete wortlos ihren Blick mir in die Augen. Ihrem Gesicht sah man an, dass sie noch jung ja blutjung war, mit typisch russischen Gesichtszügen, nicht besonders hübsch, doch lebenslustig und furchtlos. Sie sah mich an und wusste, dass ihr Erscheinen eine Wirkung auf mich ausüben würde und tatsächlich: ich erzitterte und wich zurück. Ich sah sie nicht an, aber ich spürte ihren gierigen Blick, gewürzt mit frauenhaft falscher Neugier, und es war mir, als sei es nicht der Blick dieser jungen Frau, dafür war sie noch zu jung, sondern irgendeiner Ksenia Petrowna oder Warwara Galkina...
„Wir haben keinen“, wiederholte ich, indem ich tief Atem holte, „sonst würden wir es gerne schenken…“, fügte ich unverhofft hinzu. Das kam mir wie eine Entschuldigung vor, und das ärgerte mich noch mehr.
„Na... gut...“, gab unerwartet der junge Mann nach. „Komm, Mira, wir gehen!“ Seine Stimme klang entschlossen, aber unachtsam. „Nicht gut, Kollege, ich habe für die Armenier viel Gutes getan!“ Er warf die Zigarette weg, stieß das Mädchen grob nach vorne und ging vor.
Ich bekam Mitleid mit ihnen, warum?, wusste ich nicht.
Als sie die Riede erreichten, wo es fast völlig dunkel war, wandte sich der Mann plötzlich um, fasste die Frau am Arm, kehrte sein Gesicht ganz nahe ihrem zu und sagte etwas, wovor sie zurückschreckte und erhitzt antwortete. Er warf einen Blick in meine Richtung und begann schleunigst zu flüstern. Der Mann schien die Frau offensichtlich zu irgendetwas zu überreden. „Nein... niemals!....“, lehnte sie zwischendurch wiederholt ab. Er flüsterte aber der Frau ins Ohr weiter, als könnte irgendeine dritte Person etwas mitbekommen. Schließlich sagte sie anscheinend zu, denn der Mann wurde merklich lebhafter und klatschte ihr sanft auf die Schulter. „Schon gut...“, sagte die Stimme der Frau ziemlich deutlich. Der Mann verließ sie und kam wieder munteren Schrittes herbei.
„Kollege“, sagte er mir mit fester Stimme, indem er mich am Ellbogen fasste, „komm, lass uns das letzte Gespräch vergessen…“
In seinem Äußeren, in der Haltung und in der Rede war etwas gleichermaßen Niederträchtiges, was mir verstimmte.
„Wenn du willst, kannst du es für eine Stunde haben…“, fügte er plötzlich schroff hinzu.
„Was?“, begriff ich nicht.
Er ließ meinen Ellbogen los und lächelte nachsichtig, und sein Lächeln war heimtückisch.
„Na…“, dehnte er, indem er mit dem Kopf zurück nach den Binsen zeigte, und bevor er irgendetwas hinzufügen würde, schoss mir durch den Kopf, dass es sich also um seine Freundin handelte. Ich war sprachlos.
„Wieso?“, brachte ich irgendwie niedergeschmettert hervor. „Du... also... hältst mich... für...“. Ich fühlte den Zorn in mir aufsteigen und konnte kein Wort mehr aussprechen. Ich starrte nur ihm ins Gesicht und sah höchstwahrscheinlich fürchterlich aus, denn er spielte gekränkte Unschuld und prallte unwillkürlich zurück. Noch eine Sekunde und ich würde ihm eine verpassen, doch, wie vom Blitz getroffen, wurde ich ganz mürbe vor Angst. Auf einmal fielen mir die Worte des betrunkenen Mannes am Flussufer ein, dass die Tataren von Fask hätten kommen und unser Container plündern wollen, was mir plötzlich gut möglich zu sein schien. Ich schwenkte die Hand in der leeren Luft, machte kehrt und ging langsam zur Eingangstür unseres Containers. Als ich auf die Schwelle trat, drangen noch zu meinem Ohr das enttäuschte Geschimpfe des jungen Mannes und die nervöse Stimme der Frau, die nach ihm rief, aber ich war schon drinnen.
Kapitel 5
Als ich den Container betrat, blieb ich im Licht unschlüssig stehen; einen Augenblick lang war ich erstaunt, dass es ringsherum hell war und hatte das Gefühl, irgendwoher zurückgekehrt zu sein. Ich schüttelte den Kopf, um diesen Eindruck loszuwerden, doch der Kummer ergriff mich von Kopf bis Fuß. Ich wusste nicht warum, aber mir schien, dass einer von uns fehlte. Mit einem Blick überschaute ich den Raum: Alle waren da.
Mein Altersgenosse saß mit ernstem und konzentriertem Gesichtsausdruck auf dem Bett und reparierte mit einem Draht seinen zerrissenen Schuh. Auf meinen Eintritt reagierte er nicht, doch an seiner verfinsterten Miene erkannte ich, dass mein Erscheinen ihm unbehaglich war. Ich bemühte mich, es zu ignorieren, und ging wie gewöhnlich auf mein Bett zu. Der Berg-Karabacher schlief zusammengekauert in seinem Bett. Er hatte sein Gesicht im schmutzigen Kissen und die Hände zwischen den Knien versteckt und sah wie ein frierendes kleines Kind aus. Bei seinem Anblick bekam ich starkes Mitleid mit ihm, ich dachte an das Unglück, das seiner Familie zugestoßen war, aber es lag schon irgendwie weit zurück, und ich musste nur tief seufzen. Im nächsten Augenblick kam mir mein Mitgefühl plötzlich falsch vor, ich richtete den Blick auf den Weichling und das war wie eine Flucht. Der Weichling hatte seine Lage nicht am geringsten geändert: Wie zum Zeitpunkt, als ich den Container verließ, lag er nach wie vor bewegungslos da und starrte die Decke an, die Hände über dem Bauch geschlagen. Für einen Augenblick verlor ich das Zeitgefühl: mir schien, ich sei nie fortgewesen.
„Mit wem hast du denn gesprochen?“, fragte mein Altersgenosse leise, ohne den Blick zu erheben.
„Nichts Besonderes“, sagte ich, indem ich mich auf das Bett setzte. „Ich wurde nach Kognak gefragt“. Ich machte mein Kopfkissen zurecht. „Sie halten uns wohl für melkende Kühe“, brummte ich. „Ein jeder möchte etwas von uns haben... Und die Wäsche hat man mir gekla...“.
Ich wandte mich schroff um: mein Altersgenosse sah mich finster und unentwegt an. Er schien tief gekränkt zu sein. Er glaubte wohl, dass ich auf jene Unglücksflasche Kognak anspiele, die uns wegen seines leichtsinnigen Liebesabenteuers abhandengekommen war.
„Echt”, lächelte ich, “sie wollten von uns Kognak haben“.
„Und die Stimme eines Pfauweibchens, die zu hören war?“, fragte er, während er mich mit frechem und zweifelndem Blick prüfend maß.
Ich lächelte noch breiter, ich wusste, worauf er hinauswollte. Jedes Mal, wenn ich mich für eine Zeit zurückzog, um ungestört über unsere Aufgaben nachzudenken, dachte er wohl, dass ich mich „aus dem Staub mache“, um mit schönen „Pfauweibchen“, wie er zu sagen pflegte, zusammenzukommen. Er selbst aber musste dabei auf dem Trockenen sitzen. Dies hielt er stillschweigend für eine Art Verrat von meiner Seite. Dass ich mich mit schönen Frauen „traf“, gefiel mir in Gedanken, schmeichelte meine Eitelkeit des „Hauptes“, und ich bemühte mich nicht besonders, ihm das Gegenteil zu beweisen. Doch jetzt verspürte ich ein unerklärliches Schuldgefühl und eilte zu meiner Rechtfertigung jeden Verdacht zu zerstreuen: ich erzählte ihm sowohl von den Besoffenen am Ufer, von dem, dass mir meine Wäsche geklaut wurde, als auch vom jungen Liebespaar, dem Tataren und der Russin. Während ich erzählte, fühlte ich mich mehr und mehr gedemütigt dadurch, dass ich meinem Altersgenossen Rechenschaft ablegen sollte. Ganz zum Schluss fiel es mir ein, dass er wohl die Geschichte mit der Uhrenkauf sich selber und uns eingebrockt hatte, um zu zeigen, auch er könne also das Leben genauso genießen, wie ich es vermutlich „genoss…“
Ich lächelte spöttisch und lehnte mich schweigend an die Wand. Ein paar Sekunden konnte ich den Kopf nicht heben und auf ihn schauen; ich spielte mit meiner Armmuskel, doch ich fühlte den Druck seines Blickes. Ich lächelte noch einmal und sagte genervt:
„Es ist stinkheiß...“. Erstaunlicherweise bebte meine Stimme dabei.
„Setz dich in deinen Schatten“, sagte er scharfhöhnisch. „Weiche nicht aus“, er wurde ernst und stellte den Schuh vorsichtig auf den Fußboden. „Du pflegst zu verschwinden wie der...“, er wollte wohl laut seiner Gewohnheit einen Vergleich zwischen irgendeinem hoffnungslosen Angehörigen seiner früheren Herde und mir ziehen, doch er biss sich auf die Zunge und setzte nicht fort. „Und das Ende, das dicke Ende kommt nach, was?“.
„Wer weiß?“, schnaubte ich durch die Nase, „aber etwas wird schon kommen, bestimmt...“ Ich begann mit der Hand Stück für Stück die Schlammklümpchen zu trennen, die an meiner Hose klebten. „Wie dem auch sei; kommt Zeit, kommt Rat“.
Ich fühlte mich endlos schuldig.
“Und weißt du?“, fing er an und verstummte plötzlich. Ich ahnte, dass er sich anschickte, mir durch die Geschichte des Berg-Karabachers einen harten Schlag zu versetzen und sah ihn verzeihend-skeptisch an. „Weißt du, dass dieser Mensch”, er versuchte den Blick zu verstecken und zeigte mit der Hand auf den Berg-Karabacher, “morgen nach Hause fährt?“.
„Ich weiß“, unterbrach ich ihn schroff, „besser als du...“.
„Hm... du lauscht also heimlich ab“, sprach er vieldeutig aus und erbleichte, „aber...“.
„Kümmere dich lieber um dich selber“, stichelte ich, „mach dir keinen Weg auf Kosten der Anderen frei...“.
„Meine Wege sind frei... Ich kann gehen, wann ich will...“.
„Und das Geld?“, höhnte ich.
„Zusammen mit Iwanytsch wirst du damit einen Güterzug beladen und mir nachschicken“, stichelte er seinerseits.
Ich lächelte, doch das war ein Lächeln der Niederlage. Meine Seele wurde so eng wie ein Nadelöhr. Ich fühlte, dass mir der Atem stockte. Ich klammerte mich an den Weichling an.
„Was träumst du ins Blaue hinein, du?“, ich bückte mich und stieß mit dem Zeigefinger an seine Seite. „Willst du dich nicht auch aus dem Staub machen?“
Plötzlich wurde es mir bewusst, dass ich Hilfe von ihm erhoffte.
„Ich denke, unsere Armenier sind ein kluges Volk, doch sie sind ein Dummkopf“, sagte er erfreut. „Ich bin ja nicht blöd, um wegzugehen“. Ich verstand, dass seine Ironie wiederum meinem Altersgenossen galt. „Ich werde hier eine heiraten, Kinder kriegen, und dann werde ich mich abends hinsetzen und in aller Ruhe zählen...“.
„Was, die Tage oder das Geld?“, versuchte ich zu scherzen und dadurch mich selbst zu verbessern.
„Beides zusammen!“, sagte er und setzte sich schnell auf. Wie es mir schien, heftete er den Blick spöttisch an mein Gesicht. Ich sah ihm in die kleinen gekniffenen Augen und versuchte, seinen Blick zu erhaschen, doch er schloss die Augen und prustete los, wovor der aufgesprungene Teil seiner Lippe noch spitziger wurde. Ich fand es irgendwie beleidigend. Erblasst spürte ich, dass auch er mich verließ...
„Ihr habt mir das Leben zur Hölle gemacht!“, brauste ich unwillkürlich auf, indem ich vor Wut schnaubte und mit der Faust gegen das Kopfteil meines Bettes schlug. „Haut ab, alle!..“ Ich sprang auf und machte mit den Händen abweisende Bewegungen. „Der Blöde unter euch bin ich also, dass ich mir Tag und Nacht Gedanken um euch Schafsköpfe mache!... Da habt ihr recht, macht weiter so, das habe ich verdient!.. Mensch!“, dehnte ich mit tiefster Reue und tragischer Note, „dass ich so blöd bin! Ich dachte, Iwanytsch zu besuchen“, ließ ich mir plötzlich spontan einfallen und gleich hatte ich das Gefühl, es ist schon geschehen, „ich wollte Iwanytsch besuchen, ihn anflehen, ihm zu Füßen fallen, sagen...“
Unverhofft fiel mein Blick auf meinen Altersgenossen. Mit einem traurig-feierlichen Blick sah er irgendwohin über mich hinweg, genau wie bei der Beerdigung seines Vaters, als er neben der Dielentür gestanden hatte: Mit einer Hand streichelte er das Haar seines 5 Jahre alten jüngsten Bruders, der sich an sein Bein geklammert hatte, mit der anderen tastete er über die Wand, als suchte er nach etwas, woran er sich festhalten könnte... Ganz ungelegen fiel mir noch die in der Mauer des Viehstalls versteckte Truhe seines Großvaters ein, die man nach der Beisetzung des Großvaters gefunden hatte: Man glaubte, er habe ein Vermögen hinterlassen, doch nachdem die Truhe geöffnet wurde, entdeckte man darin aus den Zeitungen ausgeschnittene Bilder von irgendwelchen Staatsmännern sowie ein Bündel von deren Reden...
„Von dir kann ich nichts behaupten, aber wir sind keine Schafsköpfe“, sagte der Weichling schwerwiegend und würdevoll. „Ich persönlich bin nicht dumm...“.
Ich wandte mich ihm zu. Er sah mich ruhig an, und sein Blick schien zu sagen: „Na, hast du es nicht erwartet?“ Es fiel mir ein, dass ich ihm Geld schuldete...
„Na schön“, wurde ich traurig, „lass mich der Dumme sein! Und weiter?“
„Weiter“, platzte der Kragen meinem Altersgenossen. Er nahm die Beine vom Bett herunter und nahm mit dem halbgedrehten Rumpf eine aggressive Haltung an. „Weiter kommt, dass ich Tag und Nacht tüchtig schufte, wieso kann Iwanytsch mein Geld unterschlagen? Ist er nicht gesetzlich verpflichtet? Hoch das Gesetz!”, dehnte er.
„Was du nicht alles sagst!“, dehnte ich ebenfalls, ihn aus irgendeinem Grund nachahmend. „Wer achtet schon das Gesetz? Du hast ja eben selber gesagt...“.
„Wieso? Was spinnst du da?“. Er wurde stutzig, und ich begriff, dass er trotz allem im Grunde seines Herzens doch noch seine Hoffnung nicht aufgegeben hatte, und ich schien ihm auch diese letzte Hoffnung geraubt zu haben. „Denkt dieser Mensch nicht daran, dass ich Kinder habe? Ich kann doch nicht mit leeren Händen nach Hause gehen?“
Plötzlich verzog sich sein Gesicht und mir schien, dass seinem Gesicht jeder menschliche Sinn entschwunden sei und allein der Zorn und der matte Blick zurückblieben, der nur harten Hass und Furcht ausdrückte.
„Du…“, brummte er bedrohlich und rückte mir näher. „Weißt du was?... Benimm dich richtig!.. Denkst du, ich weiß es nicht?“ Seine Augen blitzten.
„Was denn?“, fragte ich verständnislos.
„Meinst du, ich weiß nicht, was du vorhast? Du glaubst wohl, dass ich als Hirt nicht viel verstehe!.. Oh!..” Er drehte irgendwie vergnügt mit dem Finger über dem Kopf hin und her. „Ich kann tausend deinesgleichen um den Finger herumführen! Schaut euch mal diesen an!..“
„Schieß los“, wurde ich ärgerlich. „Was windelst du, Mensch, was erzählst du da?“
„Zwing mich nicht zu reden“, drohte er erneut. „Wenn ich es ausgesprochen habe, so werden Berg und Tal aus voller Kehle schreiend fliehen!... Soll ich es also sagen?“
„Sag!“, kochte ich schon vor Wut. „Sag endlich! Heraus mit der Sprache!“
„Gut!“, er schlug mit der Hand gegen das Kopfteil seines Bettes und sprang auf. „Also, du willst, mein liebes Bürschchen...“ Er senkte geheimnisvoll die Stimme. „Du willst, kurz, uns alle... nach Hause verweisen, um nachher das Geld, kurz, mit Iwanytsch zu teilen...“
Ich war sprachlos. Ich konnte alles erwarten, nur nicht, dass er mir so etwas sagen würde. Mir war, als stieß ich unversehens gegen etwas Dunkles und stürzte. Mein Kopf summte mir, einige Sekunden lang starrte ich ihn fassungslos an. Doch leuchtete es mir auf einmal ein: Der Fasil. Einer der Iwanytschs Hände, ein langer Kerl, Alkoholiker mit angeschwollenem Gesicht, der sich in der letzten Zeit mit meinem Altersgenossen befreundete, pflegte bald ironisch bald ernst zu sagen, der klügste Armenier unter uns wäre mein Altersgenosse und versprach ihm, eine geflochtene Peitsche zu schenken...
„Schäme dich in Grund und Boden!“, brummte ich hilflos. „Du hast den Verstand verloren und machst dich mit einem jeden Hund vertraut!...“ Ich drehte mich dem Weichling zu. „Hörst du, was dein Freund zu mir sagt?“
Der Weichling betrachtete mürrisch den Fußboden und hob nicht einmal den Kopf. Mir schien, als hätte er gleichfalls etwas Verschwörerisches im Kopf.
„Lasst mich in Ruhe!“, brummte er. „Ich habe mir schon eine Arbeit gefunden...“
„Was ist denn in dir gefahren?“, seufzte ich. „Was für eine Arbeit?“
„Was für eine Arbeit? Eine normale, eine gute Arbeit...“, kaute er die Worte. „Eine Arbeit hat ja keine Hörner!...“
Ich merkte, dass er in die Länge zog und nicht antworten wollte, doch er fügte exakt hinzu: „Der Freund von Iwanytsch braucht eine Person für die Wartung seines Wagens. Ich habe schon mit Borka ausgemacht...“
„Gut, ist klar“, sagte ich. „Dann bin also nur ich der Dorn in eurem Auge... Ich hab es verstanden, sobald es wieder hell ist, räume ich meinen Platz!“, versuchte ich einzuwirken. „Nehmt meinen herzigsten Dank entgegen... Und du“, wandte ich mich an meinen Altersgenossen, „du wirst mich sofort um Verzeihung bitten!“
„Dich?“ spottete er seine Fratze schneidend.
Mit meiner Geduld schien es zu Ende zu sein. Das war das Ende. Das Ende vom Lied.
„Jetzt schlage ich dich zu Brei!“, schrie ich und ballte die Fäuste. „Für wen haltet ihr mich?“
Ich rückte drohend auf meinen Altersgenossen zu, der mich einen Augenblick verwirrt ansah, dann sich aber eilends bückte und nach seinem zerrissenen Schuh am Fußboden griff...
Plötzlich schämte ich mich so sehr! Ich blieb stehen.
„Was ist los?.. Was ist los?..“ aus dem Schlaf gerissen, richtete sich der Berg-Karabacher im Bett auf, dessen Existenz mir völlig entfallen war und dessen Anblick mich kurz ins Erstaunen versetzte. Er sah aus matten schlaftrunkenen Augen und mit offenem Mund und kindhafter Verwunderung bald mich bald meinen Altersgenossen an. Dann rieb er die Augen und gähnte.
„Und dieser da sollte sich rächen?..“, dachte ich mir ironisch, doch sein Blick war in diesem Augenblick dermaßen naiv und seine Erscheinung dermaßen kindlich, dass ich einfach lächeln musste. Ich fühlte, dass alles irgendwie zurückkehrte und seinen gewohnten Platz einnahm. Dann hörte ich, wie mein Altersgenosse den Schuh wegschmiss, die Tür zuschlug und den Container verließ.
„Zwar bin ich heute nicht dran“, sagte der Berg-Karabacher nach einigem Schweigen, „aber ich werde schon gehen“. Er stand auf und begann sich anzuziehen.
„Wohin“, fragte ich unruhig.
„Zur Alten mit der Ziege”, sagte er naiv. „Habt ihr euch doch nicht wegen Holzhacken gekracht?...“
„Hm... übrigens“, ich besann mich und sank auf mein Bett. „Wer ist heute an der Reihe?“ Ich legte meine Hände gebieterisch auf die Knien, indem ich das Gefühl genoss, wieder eigener Herr zu sein. „Chef, bist du nicht heute dran?“ fragte ich den Weichling, der immer noch in gleicher Haltung finster da saß.
„Trinkwasser für heute habe ich selbst besorgt”, unterbrach er mich trocken. „Ich bin quitt...“
„Verdammt noch Mal! Jammert vor Hunger!“ Ich zuckte die Achseln. „Mir macht das nichts aus, ich bin ans Hungern gewöhnt“. Ich legte mich wieder hin und faltete die Hände unter dem Kopf.
Ich starrte in Erwartung, doch geschah es nichts. Die Fliegen waren auch still.
„Geh mal schauen, wo dein inniger Freund steckt“, sagte ich dem Weichling. „Nicht, dass ihn Ungeister wegzaubern...“
Der Weichling brummte etwas unzufrieden vor sich hin, wollte aufstehen, doch in diesem Augenblick kam mein Altersgenosse geräuschvoll herein. Er schleppte jenen Kalk-Sack mit, den wir einem aus einen entlegenen Dorf angereisten Bauer mit komischem Namen versprochen hatten; der Mann wollte den Sack in einigen Tagen mit einem Auto abholen, doch er kam nicht vorbei.
„Es ist schade darum, wenn es nass wird“, brummte mein Altersgenosse, indem er den Sack in einer Ecke unterbrachte. „Es rieselt“ Er trocknete sich die Hände und warf das Handtuch auf das Kopfteil seines Bettes. „Niemand kümmert sich um etwas, ohne mich...“, er brach ab, machte eine schwenkende Bewegung mit der Hand und streckte sich mürrisch auf dem Bett. Es fiel mir auf, dass seine Augen wohl feucht waren, und ich geriet auf den Gedanken, dass er geweint haben könnte...
Kapitel 6
Kurz darauf begann der Regen auf das Dach zu trommeln, zunächst mit milden Pausen, doch nach und nach immer heftiger. „Auch dieser weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht“, sagte ich vor mich hin über den Himmel. „Der hat auch den Verstand verloren...“
Einen Augenblick später wechselte es zum stürmischen Platzregen. Mir war, als hätte er uns alle im Schweigen vereint. Plötzlich graute mir dermaßen vor der Schande, mit leeren Händen nach Hause zurückzukehren, dass ich mir klein vorkam. Erneut geriet mir das Blut in Wallung vor hoffnungslosem Zorn gegen diesen sogenannten Iwanytsch, doch mit Verwunderung stellte ich fest: ungeachtet dessen, dass ich Iwanytsch aus ganzer Seele hasste und ihn befürchtete und mich vor ihm hilflos fühlte, nahm ich doch ihn in der tiefsten Ecke meines Herzens nicht ernst, vielleicht deswegen, dass er uns in einem Punkt gleich war: er war auch ein lebendiger Mensch und hatte Kopf und Fuß, Arme und Nase wie wir; und dass er aus Fleisch war, brachte unwillkürlich auf den Gedanken einer geheimen und letzten Möglichkeit, der ganzen Geschichte ein Ende zu setzen...
„Hm, was soll das schon“, begann ich mir selbst Hoffnungen zu machen, „wir tun es ... wie die Lesgier ...“.
Die Lesgier, die den ganzen Herbst und Winter und Frühling umsonst gewartet hatten, dass sie je das Verdiente ausgezahlt bekommen, setzten eines Nachts die von ihnen gebauten 12 Holzhäuser notgedrungen in Brand und verschwanden... Dann gingen sie auseinander und trieben sich herum in der Hoffnung, eine neue Arbeit finden zu können. Einem von ihnen begegnete ich in Tatarien. Das war ein bejahrter Mann mit schmutzigem zottigem Bart und in schmutziger abgetragener Kleidung. Mit seinem gebrochenen Russisch suchte er mir einzureden, nicht sinnlos umherzustreichen, sondern heimzukehren, denn daheim hungrig zu sein sei ein größeres Glück als in einem fremden Land große Hoffnungen zu machen, die einen sowieso unglücklich machen würden. Er beklagte sich bitterlich und erzählte, was ihnen zugestoßen war. Er beschimpfte in Grund und Boden irgendeinen Koreaner, der sie betrogen, die Hausbauarbeit aufgebürdet und sich zum Schluss, nachdem er ihnen das letzte Geld geraubt, um angeblich den Erhalt der Löhne zu „organisieren“, aus dem Staub gemacht hätte. Nach einer kurzen erzürnten Pause streckte der Mann den Kopf und flüsterte mir ins Ohr, auch sie seien nichts schuldig geblieben: Einen Monat später hätten ihre Jungs den Koreaner ausfindig gemacht, ihm den Hals abgeschnitten und in den Fluss geworfen. Ich nickte ihm zwar zuhörend zu, doch schenkte seinen Worten keinen Glauben, denn die Art, wie er es erzählte, verriet, dass es nur ein Selbsttrost war...
“Hm, wie bringt es man über sich, ein eigenhändig gebautes Haus in Brand zu setzen?“ sagte ich mir selbst vor mich hin, „so viel Mühe auf einmal in den Sand zu setzen!..“ Und ich wurde erneut vom Entsetzen der Ungewissheit und dem Gefühl gepackt, erbärmlich und hilflos zu sein, und begriff, dass ich mich stets in demselben Kreis bewegte und mich immer wieder im gleichen Punkt derselben Ungewissheit gegenüber befand.
Ich drehte mich mit Anstrengung, ja mit Qual zur Wand hin und fühlte erstaunt, dass mein Körper zehnfach schwerer geworden zu sein schien. Vor meinen Augen tauchte das Gesicht jener jungen Russin für einen Augenblick auf und verschwand dann wieder, und mein Körper erzitterte erneut und zuckte wie damals draußen bei ihrem Erscheinen, und ich bedauerte nur eine Weile, die günstige Gelegenheit verpasst zu haben... „So ein elender Schuft, dieser Kerl!“, brummte ich und wälzte unruhig auf meinem Bett. Ich versuchte dabei die in mir aufrührenden Bilder der Leidenschaft zu zügeln. „Und sie, sie!... Eh, egal...“, seufzte ich. Doch je mehr ich mich bemühte, diese Bilder zu vertreiben, um so chaotischer und hässlicher schwammen sie hervor. Allmählich versank ich in ihrem warmen und sündigen, samtweichen Rausch... Ich drehte mich wieder eilig auf den Rücken und verspürte, dass ich Hunger bekommen hatte. „Soll ich nicht selber zur Alten mit der Ziege gehen?“, dachte ich, aber blieb liegen. Plötzlich musste ich lächeln.
Die Alte mit der Ziege lebte ziemlich weit von uns in einem völlig verlassenen Dorf, mutterseelenallein, in einer in unvordenklichen Zeiten gebauten Hütte. Sie war eine kleine, dünne Alte unbestimmten Alters, mit runden kleinen Äugelein, mit rundlichem von unzähligen Runzeln durchzogenem Gesicht und etwas spitzem Kinn. Sie war schwerhörig und stotterte sehr stark, so dass es unmöglich war, richtig zu verstehen, was sie sagen wollte. Ihre gesamte Habe bestand aus einem schwarzweißen zottigen Ziegenbock mit prächtigem Bart und aus 12 Hühnern. Sie hatte den Hühnern allen einzeln Namen gegeben und rief sie bei diesen Namen, der Ziegenbock hieß Mele oder Male. Außerdem hatte sie einen kleinen Holzkarren, vor den sie den Ziegenbock spannte und allerlei notwendige Arbeiten erledigte. Ob sie Erben hatte oder nicht, konnte man nicht feststellen, denn bald sagte sie „ja“, bald „nein“, fügte aber immer „zehn“ hinzu, stets wohl im Glauben, dass es um die Hühner gehe. Sie lebte mit dem Bock: der Bock schlief am Ofen und sie selber hatte ihr Bett am Fenster und führte vor dem Einschlafen Gespräche mit dem Bock: Sie stotterte und der Bock leckte sich am Bein und nickte mit dem Kopf. Wir haben sie auf folgende Weise kennen gelernt: Wir waren bei der Arbeit, als wir das Gekreisch einer alten Frau vom Ufer hörten. Unter der Last des vollbeladenen Karrens war der Bock ins Rutschen gekommen, ins Wasser gestürzt und zappelte darin. Die Alte heulte und jammerte, indem sie hilflos um den Karren herumlief und sich selber das Gesicht zerkratzte. Noch bevor ich wüsste, was zu tun sei, sprang mein Altersgenosse von der Mauer herunter, warf sich zum Ufer und rettete den röchelnden Bock. Die Alte segnete uns. Dann stotterte sie lange etwas, was wir aber nicht verstehen konnten. Als wir am Abend nach Hause kamen, fanden wir in einem Tuch 10 Eier vor der Containertür liegen. Danach gingen wir jede Woche zwei-dreimal zu der Frau zum Holzhacken, und sie gab uns gekochte Eier...
Plötzlich schien mir, als lache jemand leise neben mir. Ich sah mich um und staunte, denn alle lagen still und bewegungslos auf ihren Betten. Auf den Ellbogen gestützt, erhob ich mich etwas und streckte den Hals. Auch der Weichling machte eine Bewegung und sah mich fragend an. Das Lachen wiederholte sich etwas lauter. Es war der Berg-Karabacher. Er war wieder eingeschlafen. Die Beine wie leblos im Bett ausgebreitet, hielt er mit beiden Händen den Kopf und lachte. Er lachte ein feuchtnervöses Lachen, das absonderlich klang. Es war anders als sein gewöhnliches Lachen, es war fremd. Es war, als entspringe sein Lachen aus irgendwelchen fernen und dunklen Tiefen immer mit gleicher Kraft, ohne zu erstarken, und dann klinge ab, ohne sich dabei abzuschwächen. Er lachte so, als lachte er heimlich, verstohlen, dann schmatzte er merkwürdig mit den Lippen und brummte etwas, dann lachte er wieder. Unerwartet hörte er auf, zu lachen und sagte laut und klar: „Nein, ich werde gehen...“. Und etwas später: „Du kannst es für erledigt halten...“. Er verstummte abwartend für eine Weile und lachte erneut weiter...
Der Weichling und ich sahen uns an und ich glaubte, dass wir beide an ein und dasselbe dachten. Der Weichling streckte sich und begann ihn zu schütteln, damit er erwachte. Der Berg-Karabacher setzte sich auf, doch er schien noch im Traum zu sein und sah sich mit einem matten verschwommenen Blick um. Endlich besann er sich, und unsere Blicke trafen sich. Und überraschend, so kam es mir vor, wurde er verlegen, seine Stirn bedeckte sich im Nu mit Schweiß. Wie vom Schuldgefühl geplagt, senkte er den Kopf. Ich zwinkerte ihm zu als Zeichen dessen, dass alles in Ordnung war.
„Mensch, meine Gedanken kreisen ständig um diese arme Alte mit der Ziege; sie geht mir einfach nicht aus dem Sinn“, sagte ich unerwartet, ohne zu wissen warum. „Diese Alte ist in der Tat klüger als wir...“
„Da hast du wohl keine Sorgen mehr“, sagte der Weichling gekränkt. „Musst du so viel an sie denken, dann geh und heirate sie“, höhnte er.
„Oh!“, brüllte mein Altersgenosse mit bedrückter Stimme, indem er mit dem Bein auf das Bett schlug und irgendetwas vor sich brummte. Er wandte uns den Rücken zu und versteckte den Kopf im Kissen. Nach einer kurzen Pause jedoch fügte er sein gewohntes Wort, das er gelegen oder auch ungelegen zu sagen pflegte:
„Es ist zum Weinen, und die da, die beißen sich beim Lachen in die Ohren!..“
Und wieder herrschte Stille. Die Fliegen begannen munter zu werden, und mir wurde bewusst, dass der Regen aufgehört hatte. Und plötzlich überkam mich eine solche irreale Leichtigkeit, dass sich mein Herz mit Jubel erfüllte, und es schien, dass ich nicht in mir selbst, sondern irgendwie außerhalb mir war. Vor meinen Augen sah ich einen Augenblick lang mich selbst: auf dem Bett liegend, den Mund halb geöffnet, schaue ich nach oben, die Arme unter dem Kopf. Und zum ersten Mal fühlte ich mit dem ganzen Wesen, ja mit dem ganzen Körper, unseren Zustand und jene stützlose Leere, in der wir wie in einer Höhle lebten. Mein Verstand begann fieberhaft nach den Gründen dieses Zustandes zu suchen, aber es gab sie nicht, es gab alleine ihn selbst: den Zustand. In meinem Innern kam langsam irgendein zynisches Straßenlied auf; ich wusste nicht mehr, wann und wo ich es gehört hatte. Ich machte mich rasch an das Lied und begann mitzusingen. Es war also ein Zeichen, dass das Fürchterliche, das Große Nichts, wieder heimlich zu mir schlich. Jedes Mal, wenn ich seinen Atem fühlte, begann ich unwillkürlich mit mir selbst zu reden, indem ich laut das sagte, was mir in diesem Augenblick auf die Zunge kam, oder begann ich irgendein Lied vor mich hin zu summen, als wäre nichts passiert. Es, das Nichts, kam verstohlen, geräuschlos und wischte alles, alles mit sich ab; ich kauerte mich zusammen, dann atmete ich erleichtert auf, wenn es vorbei war. Aber diesmal fühlte ich, dass es vor ihm keine Rettung mehr gab. Obwohl ich eine Zeile von diesem Straßenlied wie ein Gebet abermals wiederholte, schwamm es dennoch heran und umgab mich gänzlich mit seiner Finsternis. Vor innerem mächtigem Druck taten mir die Schläfen weh. Ich schloss meine Augen, und es gab nichts – nur Öde, Leere und Finsternis…
„Was ist denn dieses Leben?.. Und das da soll ein Leben sein?..“
Eine unendliche Zeit blieb ich in diesem Zustand, dann fühlte ich, dass ich gleichsam zurückkehrte und meine Augen langsam aufgingen.
„Es ist weg...“, dachte ich heimlich.
Mein Blick fiel auf das Fenster unseres Wohncontainers, und mich verdutzte seine Schwärze. Es schien mir, draußen ginge etwas vor sich.
Ich wandte mich mit dem Gesicht zur Tür.
An Stimmen und Lärm von draußen waren wir gewöhnt. Sobald es dunkel wurde, begann es an den gegenüberliegenden Ufern, in unendlichen Rieden, Brennnesseln-Dickichten und Mooren von Säufern, von Prostituierten, von Fischern, von Verliebten, von angeblichen „Liebespaaren“, von Dieben, von Bauern, deren Vieh ihnen abhandengekommen war, von „Unschuldigen“, die aus dem Gefängnis fliehen konnten oder auch einfach von verlaufenen Menschen wie von Insekten zu wimmeln.
Plötzlich war von der Hinterseite des Containers ein dumpfes aber bestimmtes Gepolter zu hören, als ob ein schwerer Gegenstand auf den Boden fiele, dann kam aus fernen Rieden der Ruf von irgendjemandem, der vom Kuhgebrüll übertönt wurde, und es schien, als raste einer an unserem Fenster vorbei, prallte gegen etwas und stürzte, und in demselben Augenblick war mir, als bliebe jemand vor der Tür unseres Containers stehen. Es kam mir vor, dass die stockenden Züge seines unruhigen Atems mein Ohr erreichten; er wollte gleichsam hereindrängen, aber zögerte noch.
“Die Tataren...”, ging es blitzschnell durch meinen Kopf, und unwillkürlich führte ich die Hand zum abgenutzten Stuhl, der an meinem Bett stand. Auf dem Stuhl, neben dem Aschenbecher, lag die Schere in offenem Zustand; ich nahm die Schere in die Hand und richtete mich auf, indem ich beunruhigt auf irgendetwas wartete. Der Weichling setzte sich auch auf und schaute unschlüssig auf mich.
„Ruhig!“, sagte ich. „Keiner darf hinausgehen!“.
„Ihr Feiglinge!.. Was fürchtet ihr denn vor eurem eigenen Schatten?!..“, rief mein Altersgenosse spöttisch aus, doch im nächsten Augenblick setzte er sich auch wegen des Lärms auf. Er schickte sich an, aufzustehen, aber blieb dennoch sitzen.
Auf einmal wurden alle ernst und stutzig.
Der Weichling zog seinen Koffer unter dem Bett hervor und begann mit zitternden Händen fieberhaft darin zu wühlen. Mein Altersgenosse und der Berg-Karabacher führten die Hände gleichzeitig unter die Kissen und ich verstand, dass alle innerlich stets Gefahren erwartet hatten. Durch meinen Kopf ging alles Mögliche: Angst, Streit, Leid, Unglück, Mord, Verzweiflung, Verrat, Flucht… Ich fühlte, mich nach und nach eine kalte und umsichtige Entschiedenheit überkommen. Warum auch immer fiel mir plötzlich die gebückte Figur jener riesigen dicken Frau ein, die mir einmal im Zug begegnet war: Lange Zeit quälte sie sich damit ab, ihre Schuhe anzuziehen und schien dabei übermenschliche Kräfte einzusetzen... Und im nächsten Moment schoss mir durch den Kopf, der Grund für alles, was mit uns jetzt passierte, wäre, dass ich dem Tatarenjungen, der mir seine Freundin anbot, die Fresse nicht poliert hatte…
„Pfui, Mensch, warum nur habe ich dieses Tier nicht geschlagen?“, schnaufte ich. „Warum?!..“
Gerade in diesem Moment hustete irgendeiner absichtlich kurz draußen an der Tür, indem er die Füße stampfte. Dann ging die Tür quietschend auf, und an der Schwelle tauchte eine erschreckende Gestalt auf: kleinwüchsig, mit einem großen runden Kopf, mit einer riesigen gewölbten Stirn, spitzen Backenknochen und einem breiten Kinn. Es war ein Mann vermutlich über 50 in schmutzigen, abgetragenen Kleidern und schlammigen Schuhen. Ein Auge war ihm wie genäht, und über das ganze Gesicht lief eine tiefe Narbe, die unten am Kinn in den schütteren und groben Gesichtshaaren verschwand; aber das andere, gesunde Auge, schaute eng und scharf. Der Mann war offensichtlich ein Kasache und kein Tatare. Ich versteckte sofort die Schere und war irgendwie enttäuscht…
„Was ist los?“, fragte ich kalt und feindselig, “was ist?..”
Der Mann warf einen schnellen Blick auf unsere Bleibe, als schätzte er innerlich unsere Habe ein, und ihn verwirrten durchaus weder meine aggressive Frage noch unsere unfreundlichen Blicke und düsteren Gesichter. Er machte ein paar Schritte nach vorne, und mir fiel noch auf, dass er mit dem linken Fuß hinkte. Indem er wortlos in der Mitte des Containers stehen blieb, legte er seine Rechte würdevoll ans Herz und grüßte mit leichter Verbeugung. Mein Altersgenosse trat unauffällig in seinen Rücken. Der Mann machte, ohne dass er dabei verriet, dies bemerkt zu haben, eine Handbewegung als Zeichen dessen, dass man ihn nicht so zu behandeln brauche. Er legte die Hand wieder aufs Herz und verneigte sich erneut. Mein Altersgenosse machte dennoch die Tür zu und blieb an ihr stehen.
„Ich habe das armenische Volk sehr lieb...“, wandte sich der Mann in unerwartet fließendem Russisch an mich, indem er blitzschnell erkennen konnte, dass ich anscheinend hier das „Haupt“ war. Seine Stimme war heiser und rau.
„Mach uns nichts vor“, brach ich trocken ab. „Was willst du?“
Mit erstaunlicher Ruhe, die mir beleidigend vorkam, überhörte er erneut meine Frage. Indem er sein einziges Auge nur für einen Augenblick auf den Weichling richtete, lächelte er, wie es mir schien, leicht spöttisch, und ich merkte, dass neben dem Weichling auf dem Bett sein klappbares Jagdmesser mit offener Klinke lag. Plötzlich hatte ich das Gefühl, diesen Mann irgendwo schon getroffen zu haben…
„Ich habe 11 Erben“, sagte der Mann unbeirrt, ruhig, wie es mir dünkte, auch mit verborgenem Stolz. Er heftete das sehende Auge wieder an mein Gesicht und hob die mit Tätowierungen bedeckten Hände. Die Finger spreizend, zeigte er die Zahl 10 und berührte dann mit dem Zeigefinger auch noch den Daumen. „Allah soll befehlen, dass sie nicht mehr da sind, wenn ich nicht aus dem Herzen heraus spreche...” Er steckte die Hand unter das Hemd, holte irgendein dünnes Büchlein heraus und reichte es mir.
„Ich habe für euch eine gute Ware gebracht, extra...“ Er kam noch einen Schritt näher. „Es kostet 20, aber für die Armenier, extra, 10…“ Er hob die freie Hand leicht hoch.
Meine Aufregung war weg, und als ich mich dem Mann näherte, erwachte in mir ein selbstgefälliges Gefühl der Sicherheit und Macht: ich habe die Situation im Griff. Doch im nächsten Augenblick verschwand dieses Gefühl wieder, als es mir unwillkürlich einfiel, dass wir zu viert einem gegenüber waren, der alleine da stand. Als ich das Büchlein aus der Hand des Mannes nahm, ruhte mein Blick einen Augenblick auf meinem Altersgenossen: Er stand den Kopf gesenkt, an den Türpfosten leicht gelehnt, und mich verwunderte sein sehr trauriger Gesichtsausdruck.
„Es ist etwas für die Jugend sehr gut Passendes, was Besonderes...”, sprach der Mann erneut und eine Art unbeteiligt lächelnd. Seine faulen Zähne kamen dabei zum Vorschein und das Gesicht bekam einen unverständlichen Ausdruck. „Für die Armenier kostet es 10“, erinnerte er von neuem.
Das Buch stellte vermutlich eine Geschichte dar, doch der Titel und der Name des Autors standen auf dem selbstgemachten Umschlag nicht. Das machte mich neugierig und ich überflog schnellstens den 1. Absatz, der eine schöne Beschreibung der Berge darstellte, und ich verspürte unversehens, wie mein Inneres langsam wärmer wurde und sich mein Herz zusammenkrampfte.
„Nanu!“ sagte ich aufgeregt, „es scheint, es handelt von unserem Armenien...” Ich drehte das Buch in den Händen herum. „Lasst uns es kaufen.... Wer ist der Autor?“ wandte ich mich vertraulich an diesen Mann, „wahrscheinlich ein Kasache, was?...“
Der Mann erschrak, als wäre er überrascht. Er machte einen Schritt zurück und brummte in seiner Sprache etwas vor sich hin. Mit verneinenden Kopf- und Handbewegungen wies er es energisch zurück.
Ich wurde unschlüssig.
„Na ja, das stimmt...“, sagte mein Altersgenosse mit tiefem Mitgefühl und Mitleid in der Stimme, während er auf mich zukam. „Er ist ein armer Mann... Komm, wir kaufen es... Außerdem erinnert er mich äußerlich irgendwie an meinen seligen Vater...“, fügte er mit einem Seufzer leise hinzu.
„Und das Geld?“, verlor ich den Kopf, „wir haben ja kein Geld!.. Chef“, wandte ich mich an den Weichling, der unser „Buchhalter“ war, „ist es möglich, dass bei dir irgendwo noch Geld vorhanden ist?...“
„Woher?“ ärgerte er sich, „als ob du selber nicht weißt, dass es keins gibt!“ Er machte unruhige Bewegungen auf seinem Sitzplatz. „Was hängt ihr an diesen Mann?“, wurde er plötzlich böse, „Schickt ihn einfach weg!..“
„Ach, mein Gott, gib mir Geduld!“, brummte mein Altersgenosse in den Bart, die Lippen drohend schmatzend. Eine Zeitlang sah er gehässig auf den Weichling, dann ging er entschlossen auf sein Bett zu und zog seinen Koffer hervor und holte ein paar wollene Kinderhandschuhe heraus, die er von einem Kleinhändler im Zug gekauft hatte, und gab sie dem Mann.
„Nimm!“, sagte er mit kummervoller Zärtlichkeit, „ich habe auch Kinder...“
Einen Augenblick lang sah mich der Mann verdächtig an, zögerte, dann entschloss er sich in Gedanken wahrscheinlich etwas, nahm die Handschuhe und steckte sie hastig unter das Hemd, indem er mit dem Kopf eifrig dankte. Mir gefiel seine Eile nicht, und verdüstert drückte ich leicht seine mir entgegengestreckte Hand. Mein Altersgenosse begleitete ihn bis zur Tür, die Hand gemütvoll auf seine Schulter gelegt. An die Tür gelangt, wurde der Mann überraschend redselig: Er sagte wieder, er habe das armenische Volk sehr lieb und würde alles für uns auftreiben, sei das auch auf dem Meeresgrund verborgen; er würde für uns nichts schonen, sogar sein eigenes Leben nicht...
Als er endlich fortging und ich mich wieder fasste, bedauerte ich plötzlich stark, dieses Buch gekauft zu haben, und wollte ihn zurückrufen, damit er die Handschuhe zurückgibt und sein Buch nimmt, aber es war schon zu spät.
„Auch ein Mensch…“, sagte mein Altersgenosse, nachdem er zurück war und die Tür hinter sich zugemacht hatte. Er lächelte dabei irgendwie zufrieden-schuldbewusst. Ich sah ihn an, und auch sein Lächeln gefiel mir nicht. Ich fühlte, dass in mir im Nu die frühere Beleidigung wieder ausbrach. Ich antwortete nichts.
„Ich könnte wetten, dass diesen Mann Iwanytsch geschickt hatte”, sagte der Weichling düster-tiefsinnig. „Aber was geht mich das an?..”
Kapitel 7
„Was schreibt man über Armenien?“ fragte der Berg-Karabacher beiläufig. Seine Stimme war mild und traurig.
„Lass mich mal sehen“, sagte ich und setzte mich auf mein Bett.
„Du brauchst das für alle Ewigkeit nicht“, überfiel empört der Weichling, indem er das Messer unter dem Kopfkissen versteckte. „Ist denn nicht dein Armenien schuld, dass wir in solch einer Lage sind? Armenien!.. Armenien!..“, ahmte er einem Unbekannten nach, „was für ein Armenien? Dass dein Armenien!..“.
„Hast du wieder Raupen im Kopf?“ sagte ich, mich auf das Kissen lehnend. „Du, was schreist du da?“
„Du hast gut reden…“, sagte der Berg-Karabacher dem Weichling zerstreut, „Wenn du unter dem türkischen Joch lebtest, würdest du nicht auf diese Weise sprechen“.
„Oh!..“, brummte der Weichling ironisch, „man könnte denken, dass nur deswegen, dass wir in Armenien leben, die ganze Welt vor unseren Füßen haben!..“
Der Berg-Karabacher antwortete nicht und wandte uns den Rücken zu.
Ich begann zu lesen. Plötzlich wurde ich misstrauisch, ohne zu verstehen, warum. Ich wunderte mich, aus welchem Grund ich beschlossen hatte, dass das Buch über Armenien wäre? Im Buch gab es überhaupt keine Beschreibung der Berglandschaft, sondern nur langweilige Ausführungen über irgendeine bewaldete Schlucht: in der Schlucht wäre eine längliche, schmale Villa da, umgeben mit dichten Bäumen und üppigen Büschen; und in diese Villa einzudringen, wünschen sich im Geheimen jeder und alle, aber es gelingt nur denen, die der Stimme der Natur gehorchen und ihr Leben der Idee der wahren, freien Liebe widmen...
Sowohl die Beschreibung als auch diese Idee kamen mir verdächtig vor. Ich fühlte, dass dadurch ein schlaues Spiel vorbereitet wurde und begriff so neblig, dass diese Landschaft die Allegorie des weiblichen Körpers wäre, und ich geriet in Verlegenheit. Auf der nächsten Seite sprach man schon gerade über die Villa, welche, so der Autor, nach dem Gotteswillen gerade fürs Genießen der Liebesfreiheit selbst gebaut war, und dann trat der Autor selbst mit einem Gedanken- und Phantasieflug in diese geheimnisvolle und heimliche Welt.
In einem sauberen, sorgfältig und gut eingerichteten Raum sehen wir nun auch sie, die Besitzerin, Natascha Roskowa: hochgewachsen, wohlgestaltet, reizend, leichtschwebend, flink, mit goldig schimmerndem losem Haar und tiefen, meeresblauen Augen, die nach dem Bad in einem durchsichtigen seidenen Bademantel an einem Tisch aus Eichenholz sitzt und ihrer Freundin gerade einen Brief schreibt. Auf dem Tisch liegen ihre goldenen Ohrringe, Diamantenringe, Halsketten aus Elfenbein, die feinen silbernen Armbänder durcheinander, ein ganzes Vermögen an Schmuck, das unter den letzten Strahlen der untergehenden Sonne glitzern und schimmern, doch Natascha bemerkt diese Wunderschönheit nicht, weil sie ergriffen schreibt. In ihrem Brief drückt sie ihr tiefes Bedauern aus, dass der Freundin, mit der sie von Kindheit an zusammen von der freien Welt der Liebesgenüsse geträumt hatte, das Glück verwehrt bleibt, welches ihr zuteil geworden ist. Mit tiefem Mitgefühl erteilt sie ihrer Freundin den Rat, ihren am Papier nagenden Mann, diese „abscheulichen Kanzleiratte“, zu verlassen und zu ihr zu rennen. Dann schreibt Natascha, sie sei hier von auserlesenen Menschen umgeben, die nichts, gar nichts sparen, um sie glücklich zu machen, und in diesem Augenblick, während sie den Brief schreibt, versucht einer von ihnen, ein berühmter prominenter Maler, den traumhaften Augenblick ihrer Liebe auf dem Bild festzuhalten.
Dem Brief folgte ein Intermezzo des Autors, Natascha hatte ganz recht, dass sie ihre Freundin zu sich rief, weil sie sich mit ihrem Schicksal vergewissert hatte, dass die freie Liebe und die Pflichten, die die soziale Umgebung eine Frau mit dem sehnsüchtigen Verlangen aufhalst, unvereinbar sind, dann schilderte er Nataschas Lebensabenteuer, jene Kette der Suche, die sie endlich zum Paradiesleben der freien Liebe geführt hatte: wie Natascha, die aus einer alten Moskauer Intellektuellenfamilie stammte, zum Ärger ihrer Eltern die Universität, diese „Philister-Höhle“, verlässt und, der Stimme der Natur gehorchend, an einem schönen Frühlingstag nach dem Kaukasus aufbricht. Sie ersehnte sich leidenschaftlich danach, ihren „ewigen Traum“, einen kleinen schwarzköpfigen und schwarzäugigen Buben zur Welt zu bringen, endlich zu verwirklichen. Im Kaukasus angekommen, gerät sie aber in ein ausgesuchtes Milieu und verzichtet auf ihre Absicht: Sie widmet sich völlig nicht irgendjemandem oder einer „Zufalls-Person“, sondern gerade ihr, der Liebe selbst; denn die Liebe...
Der Lebenslauf von Natascha Roskowa langweilte mich, und ich begann die Seiten des Buches nervös nach vorn und nach hinten zu blättern, dabei fühlte ich ganz bestimmt, dass in mir irgendein Verlangen erwachte, und dass sich auch meine Gedanken nach und nach schwerfällig wurden. Plötzlich kam ich darauf, dass ich in diesem Buch nach etwas anderem suchte. Ich schlug das Buch heftig zu und dann, laut meiner Gewohnheit, öffnete ich die erste beste Seite in der Mitte und begann zu lesen. Nach einer kurzen Weile wurde es mir warm und zugleich kalt, und ich fühlte mein Gesicht stark erröten, als wäre ich mit zwei Füßen in die Falle geraten: was hier beschrieben wurde, übertraf jeden Zynismus. Es war mir, als ob das Buch in meinen Händen brannte: bald wollte ich es zerreißen, wegwerfen, bald zwang mich eine unbekannte Kraft, möglichst schnell alles zu verschlingen, zu verschlucken, und ich verstand, dass ich mit einem tiefen und düsteren Betrug zu tun hatte... Das Leben, die Welt alles vermischte sich in mir und wurde zu einer trüben glühenden Masse; alle bekannten und unbekannten Heiligtümer, Schmerzen, Träume zerstäubten sich; Grenzen, Schlösse und Verschlüsse verschwanden, und es war mir, als ersticke ich im klebrigen warmen Schlamm. Wie im Fieber erinnerte ich mich an das schlammig-leblose Gesicht des jungen Mannes am Flussufer, und es schien, dass ich wieder den sich von ihm ausbreitenden Gestank roch. Ich zuckte zusammen und spürte deutlich, dass ich mich unwiederbringlich verlor. Ich schloss die Augen fest, schwer und stockend atmend, aber dieser Alpdruck blieb auch unter meinen geschlossenen Augenlidern erhalten. Die Galle der Beleidigung, einer unbegrenzten und tiefen Beleidigung fasste mich bei der Gurgel, und ich entsann mich der Kinderhandschuhe und hätte beinahe geweint. Aber eine Sekunde später verwandelte sich meine Aufregung, unabhängig von mir in eine Empörung, die Empörung in eine trockene und grausame Wut. Ich warf das Buch mit aller Kraft wütend weg, das sich stark an den Fensterrahmen stieß und offen mit dem Rücken nach oben auf den Boden fiel.
„Was ist mit dir?“ fragte erstaunt der Weichling, im Bett halbsitzend. „Eine Weile zuvor ging es dir gut…“ Er legte den Finger an die Schläfe und drehte ihn, er wollte damit zeigen, ich wäre verrückt geworden, dann stand er auf. Mein Altersgenosse sah mich schwerwiegend an, bewegte die Lippen, vermutlich wollte er mir etwas Bissiges sagen, aber er schluckte nur den Geifer: er sah niedergeschlagen aus.
Der Weichling nahm das Buch, schüttelte es sorgfältig ab und begann von der geöffneten Stelle an zu lesen. Die Brauen mit Mühe zusammengezogen, las er eine Weile mit einem gespannten Augenausdruck und dann, als er eine Stelle erreichte, zögerte er, lächelte, wurde rot, dann verzog er leicht das Gesicht düster dreinschauend.
„Und du sagtest, es sei über Armenien!“, sagte er mit einer leichten Schattierung des Vorwurfs, ohne mich anzusehen. „Hm... und wie kann man mit Druckbuchstaben solche schmutzigen Sachen schreiben?“ fügte er mit einem bekümmerten Erstaunen hinzu. Er machte das Buch zu, überlegte sich ein wenig, dann legte er es unter den Arm und ging zur Tür. Seine Ruhe wunderte mich, weil gerade er am meisten von solchen Sachen sprach und während der Arbeit an die in der Ferne vorbeigehenden jungen Frauen zuweilen scharfsinnige, zuweilen mäßig-unanständige Grüße richtete.
„Wohin gehst du denn?“ fragte ich ihn.
„Nach Armenien“, kam seine Antwort schon von draußen her.
Nach einer Weile flammte das schwarze, undurchsichtig schwarze Fenster mit einem schwankenden Licht auf, und ich verstand, dass der Weichling das Buch vermutlich in Brand steckte, und ich fühlte einen Augenblick etwas wie Bedauern. Eine Zeitlang herrschte Stille, dann war es zu hören, wie er mit dem Fuß die Asche feststampfte, indem er etwas brummte.
Ich atmete erleichtert auf.
„Oh, Hilfe!... Die Natascha brennt!“, rief der Weichling schauspielerisch von draußen herein.
Er stürmte geräuschvoll herein, blieb an der Tür stehen, neigte kläglich den Kopf und streckte uns gegenüber flehend die Hände. „Jungs, Natascha... wie war ihr Familienname?... ja, Rakowna!... Natascha Rakowa brennt!...“
„Wieder macht er Blödsinn“, brummte mein Altersgenosse unzufrieden vor sich hin. „Und mit diesem Verstand will er eine Frau nehmen!“ Mit der Faust schlug er gegen das Kissen und wandte das Gesicht vom Weichling ab. „Pfui!“, sagte er und fügte absichtlich laut hinzu: „Dabei stellt er sich wie ein Affe!“.
Der Weichling ignorierte die Ausrede meines Altersgenossen. Man wusste es nicht, warum er so begeistert feierlich aussah. Seine Augen blitzten munterwild und ein bisschen ironisch. Die Augen zugekniffen betrachtete er aufmerksam uns alle einzeln und schrie plötzlich: ”Hra-ho!!!..”
Und er stürzte los, indem er Beifall klatschte und die Hände eifrig rieb, und an meinem Altersgenossen hastig herantretend, reichte er ihm schauspielerisch die rechte Hand.
„Erbarme dich, mein Gott!“, brüllte mein Altersgenosse drohend und schnalzte mit den Lippen. „Mach, dass du weiterkommst!“, schnaufte er, aber die Härte in seinem Ton war schon gebrochen.
Der Weichling entriss mit Gewalt seine Hand, zog sie von unter dem Kissen mit Mühe hervor und begann sie mit aller Kraft zu schütteln. Gleich darauf ließ er auf einmal meinen Altersgenossen los, trat an den Berg-Karabacher heran, der im Bett halbsitzend mit einem leichten-feuchten Lächeln das alles beobachtete, schüttelte auch ihm die Hand.
„Hra-ho!!!..”, schrie der Weichling nochmals aus voller Kehle.
Er kam auf mich zu, beugte sich mit dem ganzen Körper möglichst nach hinten und machte mit der Hand eine Drehbewegung, dann führte er sie mit der ganzen Kraft auf mich zu und wir begrüßten uns, indem wir uns gegenseitig in die Hände schlugen.
„Worauf freust du dich so?“ fragte ich lächelnd und fühlte, dass seine Begeisterung, seine sorglose Munterkeit auch mich ergriff.
„Soll es unbedingt einen Grund geben, um sich zu freuen?“ sagte er schnell und leichthin. „Hauptsache sind wir heil... Hra-ho!!!..“
Er drehte sich um die Ferse herum, schlug mit dem Gesicht auf das Bett hin und begann mit Füßen gegen das Bett zu toben.
„Hra-ho!“, rief unerwartet mein Altersgenosse von seinem Bett nach. Er richtete sich im Bett, steckte zwei Finger in den Mund und begann mit der ganzen Kraft zu pfeifen, indem er sein ganzes Können des Hirten einsetzte: er pfiff meisterhaft und mit verschiedenen Klangfarben und Tonstärken, als wäre er bei seiner Herde in Berdassar. Ich hielt mir die Ohren zu, ich spürte, dass in mir eine wilde lebhafte Freude zu wallen und brausen begann.
„Hra-ho!..“, ertönte auch die Stimme des Berg-Karabachers zuerst scheu, dann aber immer sicherer und mutiger. „Hra-ho!..“
„Hra-ho!!!..“
„Hra-ho!!!..“
„Hra-ho!!!..“
Nach einer Weile dröhnte schon der Container von diesen einmütigen, wilden und lauten Schreien, und in der Luft schwebte sie selbst, die erhabene und leuchtende Kraft.
„Jetzt werden all die bösen Geister und Teufel, die es draußen gibt, vor Ort verdorren“, sagte ich lachend, doch meine Stimme verlosch in diesem Geschrei. „Bitte etwas leiser... singen!..“
Ich wich zurück, lehnte mich an die Wand an, und plötzlich schienen mir all diese Leiden, Streite, Träume, Sorgen klein und winzig zu sein, winzig und auch irgendwie ausgeklügelt...
Ich lächelte, schloss die Augen und fühlte plötzlich mit erstaunlicher Klarheit, dass das Leben, dass wir lebten, vorbei sein würde, vorbei ging und es schien mir sogar einen Augenblick lang, dass es schon ganz vorbei war.
© Naira Sukiasyan
© Karine Hovhannisyan
© Sevak Aramazd
Prosa
 SEVAK ARAMAZD, DIE STEPPE
SEVAK ARAMAZD, DIE STEPPE
 SEVAK ARAMAZD, DER TOD DER MUTTER
SEVAK ARAMAZD, DER TOD DER MUTTER